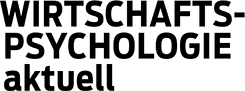Unsere Vorstellung ist der Gamechanger für unser Handeln. So, wie Sportler*innen im mentalen Training die Kraft der Vorstellung bei der Wettkampfvorbereitung nutzen, kann das „Kopfkino“ auch im Arbeitsleben Lernprozesse und Leistungen beeinflussen.
Unsere Vorstellungskraft ermöglicht es uns, über uns hinauszuwachsen. Als Roger Bannister am 6. Mai 1954 in 3:59:04 Minuten nicht nur den Weltrekord auf einer Meile verbesserte, sondern auch als erster Mensch überhaupt unter vier Minuten lief, wurde eine Grenze verschoben. Die vier Minuten galten bis dahin als nicht zu erreichen. Die Überraschung: Was zuvor trotz Versuchen über Jahre nicht gelungen war, schafften nach Bannisters Rekord in kürzester Zeit mehrere Läufer. Bannisters Weltrekord hielt nicht einmal zwei Monate und die scheinbar magische Grenze schien sich in Luft aufgelöst zu haben – es war nun vorstellbar, dass ein Mensch die Meile unter vier Minuten laufen kann. Die Geschichte vom Läufer Bannister erzählt, wie Bilder im Kopf unsere Leistungsfähigkeit beeinflussen.
Sportler*innen nutzen die Kraft der Vorstellung ergänzend zum Training, um ihr Potenzial auszuschöpfen. Dabei geht es nicht bloß um Tagträumereien und Erfolgsfantasien, sondern um systematisches und gezieltes Training. Das Vorstellungstraining umfasst als eine Form des mentalen Trainings eine Simulation von Bewegungen und Situationen, ohne dass eine äußere Handlung beobachtbar ist (Lindsey et al., 2021). Ein wesentliches Trainingsprinzip ist die Wiederholung. Im Kopf werden Bewegungen und Situationen mehrfach durchgespielt, es wird sozusagen „Kopfkino“ betrieben. Zudem geht es darum, lebhafte und detaillierte Vorstellungen zu schaffen, die mehrere Sinnesebenen ansprechen (Engbert & Kossak, 2021).
Wirkung des mentalen Trainings
Das mentale Training wirkt dabei u. a. auf
- Motivation und Selbstwirksamkeit,
- Training und Erhalt spezifischer Fertigkeiten und Festigung von allgemeinen Abläufen (z. B. Vorbereitung vor einem Start),
- Emotionsregulation (z. B. Reduktion von Angst und Lampenfieber, Versetzen in einen guten Wettkampfmodus).
Zur Steigerung der Motivation und Selbstwirksamkeit malt sich beispielsweise eine Athletin aus, wie sie auf dem Podium steht, oder ein Athlet stellt sich das Flowerleben im Wettkampf vor. Die Zielerreichung wird im besten Fall durch das Kopfkino noch attraktiver und erscheint dadurch greifbarer. Auch im Arbeitsleben lässt sich dies anwenden.
Leistungssituationen im Arbeitskontext
Sportler*innen müssen ihr Leistungspotenzial in einem bestimmten Moment abrufen können. Auch im Arbeitsleben gibt es Situationen, bei denen eine Leistung zu einer bestimmten Zeit erbracht werden muss. Im Arbeitskontext lassen sich solche Situationen jedoch häufig nicht üben, sondern nur gedanklich planen. Folglich kann die Selbstwirksamkeit in Leistungssituationen im Arbeitskontext aufgrund fehlender Erfahrung gering sein und die Furcht vor Misserfolg womöglich überwiegen.
Dem können Sie entgegenwirken, indem Sie Leistungssituationen motivierend gestalten und Furcht vor Misserfolg durch Erfolgszuversicht ersetzen: Wenn ein*e Projektmanager*in das erste Mal eine Präsentation beim Vorstand hält, kann er bzw. sie die Präsentation zuvor durchspielen und sich ausmalen, wie sie erfolgreich verläuft und was dafür erforderlich ist. Führungskräfte können ihre Mitarbeitende auch durch Fragetechniken unterstützen, konstruktive Vorstellungen zu entwickeln. Dafür eignen sich lösungsorientierte Fragen (z. B. „Was müsste geschehen, damit das Problem gelöst wird?“), hypothetische Fragen („Angenommen, du hast die Herausforderung gemeistert. Was genau hast du getan, damit es so gekommen ist?“) oder Fragen zu Sinneseindrücken („Angenommen, es läuft richtig rund. Was siehst, hörst und spürst du?“).
Bewegungen lernen und optimieren
Mentales Training umfasst jedoch auch die körperliche Leistungsfähigkeit, denn Bewegungsabläufe lassen sich ebenfalls durch mentales Training verbessern. Die Vorstellung umfasst mehrere Sinnesebenen, im Sport insbesondere kinästhetische Empfindungen bei der gedanklichen Durchführung von Bewegungen. Diese Art des Vorstellungstraining wirkt sich positiv auf die Leistung aus, v. a. in der Kombination mit „echtem“ Training (Lindsey et al., 2021; Simonsmeier et al., 2020).
Es liegt nahe, dass in Berufen, in denen motorisches Geschick erforderlich ist, wie im Handwerk oder in der Chirurgie, mentale Vorstellungen lern- und leistungsförderlich sind. Doch auch bei Wissensarbeiter*innen gibt es Bewegungsabläufe, die mental trainiert werden können. Seien es die kleinen Bewegungen der Maus am Computer, mit der verschiedene Softwarefunktionen in einer bestimmten Reihenfolge durchlaufen werden müssen, oder Situationen, in denen motorische Fertigkeiten gefragt sind (z. B. das Schreiben in Flipchartschrift). Insbesondere in Leistungssituationen, in denen die Zeit knapp ist und „jeder Handgriff“ sitzen muss wie bei einem Vortrag auf einer Bühne, spielen auch Bewegungen (z. B. zum Publikum) eine Rolle.
Im Arbeitsalltag können Fokuszeiten helfen, Aufgaben detaillierter zu planen. Dafür können sich Mitarbeitende bewusst Zeitfenster im Kalender blocken. Die Aufmerksamkeit sollte im Vorstellungstraining konkret auf den Handlungen und deren Ausführung liegen. Beispielsweise würde es für nicht ausreichen, an die benötigten Informationen zu denken, sondern man sollte konkret im Kopf durchspielen, wie die Informationen beschafft werden können.
Hilfreich kann es sein, Vorstellungen zu verschriftlichen, indem Handlungsschritte z. B. in jeweils ein bis zwei Sätzen beschrieben werden. Leitfragen wie „Was tue ich mit welchem Ziel?“ oder „Welche Stimmung wäre förderlich für die Handlung?“ können bei der Entstehung von Bildern im Kopf helfen. Ein Anfang kann darin bestehen, sich auf einer Seite fünf wichtige Handlungsschritte zu notieren und diese dann im Kopf durchzuspielen.
Lampenfieber reduzieren
Bei Leistungsdruck, z. B. in Vortrags- oder Verhandlungssituationen, spielen wie im Sport auch die Regulation von Emotionen und die Aktivierung eine zentrale Rolle.
In diesen Situationen steht oft viel auf dem Spiel. Um das Lampenfieber gering zu halten und Ängsten vorzubeugen, eignet sich das Vorstellungstraining ebenfalls. Beispielsweise erhöhen Sportler*innen ihre Handlungssicherheit, indem sie vor einem Wettkampf im Kopf Abläufe durchspielen. Sich mental und nicht nur fachlich auf Leistungssituationen vorzubereiten, kann sich in besserer Leistung auszahlen.
Prinzipien und Varianten des Vorstellungstrainings
Als Prinzipien des mentalen Vorstellungstrainings lassen sich ausmachen:
- Zielgerichtetheit: Je nach angestrebtem Effekt (z. B. Motivationssteigerung vs. Einüben von spezifischen Bewegungen) wird der Inhalt und Fokus gewählt.
- Wiederholung: Wesentlich ist, dass Bewegungen und Situationen mehrfach durchgespielt werden.
- Hohe Anschaulichkeit: Man stellt sich verschiedene Sinnesempfindungen vor (z. B. Sehen, Spüren, Fühlen, Hören, Riechen, Schmecken).
- Steigerung mit den Anforderungen: Mit der Zeit wird die Komplexität des Trainings gesteigert, um die Effekte zu erhöhen.
Ferner gibt es beim Vorstellungstraining verschiedene Varianten:
- Vorstellungstraining im entspannten Zustand eignet sich gut für den Einstieg.
- Vorstellungstraining unter dem Druck einer Leistungssituation simuliert stärker eine Leistungssituation.
- Die Vorstellung aus einer Beobachtungsperspektive ist für Einsteiger*innen geeignet.
- Die Vorstellung wie in einem Computerspiel aus der Ich-Perspektive entspricht mehr der Realität.
Bezüge zu systemisch-konstruktivistischen und handlungstheoretischen Ansätzen
Mentales Vorstellungstraining eröffnet oft neue Perspektiven. Die Geschichte von Roger Bannister zeigt, wie Vorstellungen des Machbaren anspornen können. Systemisch-konstruktivistische Beratungsansätze nutzen Vorstellungen und erschließen durch gezielte Fragen wie die Wunderfrage Möglichkeitskonstruktionen, um Ressourcen zu aktivieren und die Selbstwirksamkeit zu steigern.
Ferner gibt es Bezüge zu handlungstheoretischen Ansätzen (z. B. Hacker & Sachse, 2014). Handlungen sind demnach sequenziell-hierarchisch strukturiert, umfassen unter anderem Zielsetzungen und Planungsprozesse und werden durch mentale Modelle unterstützt. Das Vorstellungstraining fördert v. a. Planungsprozesse, indem diese besonders anschaulich und lebhaft wiederholt werden, sodass mentale Modelle entstehen.
Fazit
Mentales Vorstellungstraining ergänzt im Leistungssport das körperlich anspruchsvolle Training. Im Kopfkino werden verschiedene Vorstellungen aktiviert, um Motivation und Selbstwirksamkeit zu steigern, Bewegungsabläufe einzustudieren oder sich auf Situationen vorzubereiten, bei denen Leistung auf den Punkt abgerufen werden muss. Im Arbeitskontext können Sie mentales Training ebenfalls nutzen, um Handlungen zu planen und effektiver umzusetzen.
Literatur
Engbert, K., & Kossak, T. (2021). Mentales Training im Leistungssport-Teil 2. Neuer Sportverlag.
Hacker, W., & Sachse, P. (2014). Allgemeine Arbeitspsychologie: Psychische Regulation von Tätigkeiten. Hogrefe.
Lindsay, R. S., Larkin, P., Kittel, A., & Spittle, M. (2023). Mental imagery training programs for developing sport-specific motor skills: a systematic review and meta-analysis. Physical Education and Sport Pedagogy, 28(4), 444-465.
Simonsmeier, B. A., Andronie, M., Buecker, S., & Frank, C. (2021). The effects of imagery interventions in sports: A meta-analysis. International Review of Sport and Exercise Psychology, 14(1), 186-207.