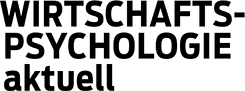Konflikte lähmen – oder bringen uns weiter. Wie klären Sie mit mediativem Handeln Missverständnisse, stärken Beziehungen und schaffen selbst in festgefahrenen Situationen wieder Verbindung? Darum geht es in diesem Beitrag.
Konflikte gehören zum Leben dazu und sind in unserem Alltag allgegenwärtig. In Unternehmen, Teams, Partnerschaften, Familie.
Oft geht es nicht um die „großen“ Dramen, sondern um alltägliche Reibung: Missverständnisse, unausgesprochene Erwartungen, unklare Rollen. Solche „kleinen Risse“ können Beziehungen schwächen, Teams lähmen und Entscheidungen blockieren. Sie führen damit zu Frust, Ineffizienzen und echten Kosten.
Diese „Risse“ lassen sich nicht einfach wegmoderieren. Genau hier beginnt Mediation. Nicht als Richterspruch oder Machtverhandlung, sondern als strukturierter, geschützter Raum für nachhaltige Klärung.
Mediation – nicht erst, wenn es brennt
Oft wird Mediation mit Krisensituationen assoziiert – als Ultima Ratio, wenn die Situation eskaliert ist. Doch das greift zu kurz. Mediation ist kein „Spezialverfahren für Spezialfälle“, sondern ein Kompetenzpaket, das Führung und Zusammenarbeit wirksam stärkt.
Mediative Kompetenzen wie aktives Zuhören, Perspektivwechsel und das Erkennen der Bedürfnisse hinter Positionen helfen, Konflikte frühzeitig zu erkennen und produktiv zu bearbeiten. Dabei geht es nicht um richtig oder falsch. Es geht darum, wieder in Verbindung zu kommen – mit sich, dem Gegenüber und dem, was wirklich wichtig ist.
Mediation – ein strukturierter Prozess
Mediation ist ein freiwilliger, vertraulicher Prozess, in dem zwei oder mehr Parteien – begleitet durch eine neutrale Dritte – wieder ins Gespräch kommen. Nicht oberflächlich, sondern ehrlich. Mit allem, was da ist: Interessen, Bedürfnissen, Emotionen, Ängsten.
Das Vorgehen ist dabei klar strukturiert (vgl. Bähner et al., 2008; von Hertel, 2013):
- Einzelgespräche & Vertraulichkeit
Ziele: Vertrauen aufbauen, Anliegen und Perspektiven verstehen – ohne Bewertung. - Auftragsklärung
Ziel: Gemeinsam klären, worum es in der Mediation geht und worum nicht. - Themenklärung & Verstehen
Ziele: Herausarbeiten, was wirklich wichtig ist. Als ganzer Mensch mit den eigenen Intentionen und Bedürfnissen gesehen werden und die anderen Beteiligten genauso sehen können. - Lösungsentwicklung
Ziel: Auf Basis des Verstehens tragfähige Lösungen entwickeln – keine faulen Kompromisse, sondern echte Verständigung. -
Abschlussvereinbarung
Ziel: Getroffene Vereinbarungen schriftlich festhalten. Was setzt wer wann um? -
Follow-up / Evaluation
Ziel: Die Nachhaltigkeit der Einigung sicherstellen. Was hat sich bewährt und was braucht ggf. eine Anpassung?
Mediation – nicht immer die geeignete Methode
Mediation ist ein freiwilliger Prozess. Freiwilligkeit bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Beteiligten sich ohne äußeren Zwang entscheiden können, ob sie ihren Konflikt durch eine Mediation beilegen wollen (vgl. §1 Abs. 1 Mediations-Gesetz) Eine dritte Person oder Instanz kann eine Mediation zwar empfehlen, nicht jedoch „verordnen“. Die beteiligten Parteien müssen selbst erkennen, dass ein mediatives Verfahren attraktiver als mögliche Alternativen – der sogenannte „Plan B“ – ist.
In der Praxis kommt es immer wieder vor, dass einer Mediation nur vordergründig zugestimmt wird, obwohl bei genauerem Hinsehen noch keine echte „Mediationsreife“ vorliegt. Oft fehlt entweder die wirkliche Freiwilligkeit oder eine Partei möchte gar nicht gemeinsam an einer Lösung arbeiten, sondern vielmehr ihre eigene Position um jeden Preis durchsetzen.
Eine wichtige Aufgabe aller Mediator*innen besteht darin, die wahren Gründe für eine ablehnende Haltung herauszuarbeiten: Was steckt hinter Zurückhaltung oder Widerstand? Ziel ist es, die Beteiligten für eine Mediation zu öffnen – oder klar zu erkennen, dass dieses Verfahren in der aktuellen Situation nicht geeignet ist.
Praxisimpulse für den Alltag
Auch wenn nicht jede Situation eine formale Mediation braucht: Viele mediative Elemente lassen sich in Führungs- und Beratungssituationen integrieren. Hier einige Fragen und Haltungen, die Klarheit und Verbindung fördern können:
- „Wofür ist Ihnen diese Klärung wichtig?“
- „Worum geht es Ihnen eigentlich – jenseits der konkreten Forderung?“
- „Was brauchen Sie, um sich gesehen oder gehört zu fühlen?“
- „Was ist Ihnen so wichtig, dass Sie sich darüber ärgern?“
- „Wie würde die andere Person die Situation beschreiben?“
Diese Art des Fragens braucht Zeit, Präsenz und manchmal auch den Mut, Stille auszuhalten. Doch sie öffnet Räume, in denen neue Verständigung möglich wird.
Fallbeispiel: Betriebsleiterin & Vorgesetzter
Der Ablauf einer Mediation ist selten linear – er folgt einer inneren Logik. Das zeigt das folgende Beispiel aus meiner eigenen Arbeit deutlich:
In den Vorgesprächen schilderten beide Parteien – eine Betriebsleiterin und ihr Vorgesetzter – eine emotional belastende und wirtschaftlich angespannte Situation. Die Mediation sollte Klärung schaffen und zugleich ein wesentlicher Entscheidungspunkt in Bezug auf die Frage „Können und wollen wir weiter zusammenarbeiten?“ sein.
In der gemeinsamen Auftragsklärung einigten sich beide auf folgende Themen:
- Rollen: Wer hat welche Rolle und welche Erwartungen sind damit verbunden?
- Austausch & Feedback: Wie gelingt eine konstruktive Kommunikation?
- Zukunftsperspektive: Wie soll es weitergehen?
Im ersten gemeinsamen Termin konnten zwei dieser Themen gut bearbeitet werden. Im gemeinsamen Dialog wurden die Rollen beschrieben und konkretisiert. Die folgenden Fragen zeigen beispielhaft das Vorgehen:
- Was ist (nicht) Rolle und Verantwortlichkeit der Betriebsleiterin/des Vorgesetzten?
- Welche Erwartungen werden an diese Funktionen geknüpft?
- An welchen konkreten Aufgaben und Tätigkeiten machen wir das fest?
- Welche Beispiele haben wir, an denen das bereits gut bzw. noch nicht funktioniert hat?
- Was verändert sich, wenn wir diese Rolle und Verantwortlichkeiten wahrnehmen?
Immer wieder ging es darum, die jeweilige Intention oder das Bedürfnis sichtbar zu machen sowie Sorgen und Befürchtungen auszusprechen. Erst dadurch konnten gegenseitiges Verständnis und erste Lösungsansätze entstehen – selbst ohne völlige Einigkeit.
Das zentrale Thema – die grundsätzliche Entscheidung zur weiteren Zusammenarbeit – blieb zunächst offen. Die vereinbarten Maßnahmen, z. B. tägliche Feierabend-Telefonate, wöchentlicher Jour-Fix, regelmäßiger gemeinsamer Blick auf die Kennzahlen, Nicht-Teilnahme des Vorgesetzten an operativen Meetings, wurden als „Testphase“ definiert. Ein Folgetermin nach drei Monaten sollte prüfen, wie tragfähig die Vereinbarungen waren.
Zwischenzeitlich wurden erneut Einzelgespräche geführt. Beide berichteten von Fortschritten, aber auch von anhaltenden Spannungen. Die Betriebsleiterin äußerte deutlich: Sie brauche für eine Zukunft in der Organisation ein klares „Ja, ich will weiter mit dir als Betriebsleiterin arbeiten!“. Ausgesprochen und spürbar. Ihr Vorgesetzter konnte das nicht geben. Die Zusammenarbeit fühlte sich für ihn weiterhin nicht stimmig an, auch wenn er dies lange nicht offen aussprach. Der zweite gemeinsame Termin wurde mehrfach verschoben.
Schließlich suchte der Vorgesetzte wieder das Gespräch. In einem klärenden mediativ begleiteten Prozess wurde deutlich: Er hatte innerlich bereits Abstand genommen. Er wollte nun einen respektvollen Trennungsprozess initiieren.
Die von ihm vorgeschlagenen Alternativen für andere Funktionen innerhalb der Organisation waren für seine Mitarbeiterin nicht attraktiv. So änderte sich der Fokus der Mediation – von der Klärung der Zusammenarbeit zur Gestaltung einer respektvollen Trennung.
Dieses Beispiel zeigt: Mediation ist dynamisch. Einzel- und Gruppengespräche können sich abwechseln. Lösungsansätze sind manchmal nur Zwischenstationen. Ziel bleibt immer: in Verbindung zu kommen – mit sich, dem Gegenüber und dem, was wirklich wichtig ist. Auch wenn der Weg schmerzhaft ist. Auch, wenn die ursprünglich erhoffte Lösung nicht eintritt.
Fazit: Mediation ist eine Haltung
Mediation ist mehr als ein Verfahren – sie ist eine Haltung: zuhören, erkennen, was wirklich gemeint ist und gemeinsam tragfähige Wege entwickeln. Diese Haltung können wir in vielen Situationen leben – als Führungskraft, als Kolleg*in, als Coach.
Sie verändert nicht nur, wie wir mit Konflikten umgehen. Sondern auch, wie wir Beziehungen gestalten – klarer, ehrlicher, menschlicher.
Literatur
Bähner, C., Oboth, M., & Schmidt, J. (2008). Praxisbox Konfliktklärung in Teams & Gruppen. Junferman.
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. 2012. Mediationsgesetz (MediationsG). https://www.gesetze-im-internet.de/mediationsg/index.html.
Von Hertel, A. (2013). Professionelle Konfliktlösung: Führen mit Mediationskompetenz. Campus Verlag.