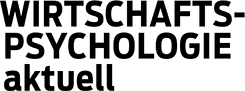Tests, die Menschen verschiedenen Persönlichkeitstypen zuordnen, sind auch im Arbeitskontext beliebt. Doch ist es sinnvoll, die Personalauswahl auf Typentests zu stützen? Die wissenschaftliche Evidenz gegen die Belastbarkeit solcher Typisierungen nimmt zu.
In der Welt der Persönlichkeitspsychologie sorgt eine Studie von Gerlach et al. (2018) bis heute für Diskussionen: Die Forschenden postulierten damals vier Persönlichkeitstypen und erhielten dafür breite mediale Aufmerksamkeit. Doch wie belastbar sind Modelle wie dieses wirklich?
Die Kommentare von Freudenstein et al (2019) in „Nature Human Behaviour“ und von Kentaro et al. (2020) aus „Frontiers in Big Data“ rücken die Dinge zurecht – mit einem klaren wissenschaftlichen Appell zur Vorsicht. In ihren Beiträgen hinterfragen sie die Methodik und die Aussagekraft des ursprünglichen Befundes kritisch und liefern einen Denkanstoß zur Typisierung menschlicher Persönlichkeit.
Der Kern der Kritik: Weder robust noch vollständig
Die Autoren zeigen auf, dass die Typisierung in die vier postulierten Persönlichkeitstypen nicht robust ist – also sich in anderen Untersuchungen nicht mehr zeigt. Ebenso wenig erscheinen sie erschöpfend – sprich: Es ist fraglich, ob sie das Spektrum menschlicher Persönlichkeit überhaupt annähernd abbilden (Freudenstein, et al., 2019).
Ein weiteres Argument: Die verwendeten Cluster-Analyse-Methoden können in großen Datensätzen auch dann Strukturen finden, wenn keine echten Kategorien existieren. In diesem Fall entstehen Typen nicht aus der Realität, sondern aus den mathematischen Modellen selbst – eine Art statistische Fata Morgana (Kentaro et al, 2020).
Typentests – nicht besser als ein Münzwurf?
Besonders kritisch ist der Blick auf Typentests, die oft im beruflichen Kontext – etwa bei der Personalauswahl – verwendet werden. Was viele nicht wissen: Die Aussagekraft solcher Arten von Tests ist äußerst begrenzt. Forschende der Humboldt-Universität zu Berlin, der Freien Universität Berlin und der Universität Ulm konnten zeigen, dass die Zuverlässigkeit typisierender Persönlichkeitstests nicht besser ist als der Zufall (Freudenstein, et al., 2019).
Prof. Dr. Matthias Ziegler, einer der Co-Autoren der kritischen Studie, erklärt: „Wir haben speziell darauf geachtet, ob jede Person einem der vier Persönlichkeitstypen zugeordnet werden kann, und falls ja, wie sicher diese Zuordnung ist.“ (HU Berlin, 2019). Das Ergebnis: Nur 42 % der getesteten Personen ließen sich einem Typ zuordnen – und selbst das mit einer Sicherheit, die dem Ausgang eines Münzwurfs gleicht.
Persönlichkeit: Dimension, Typ oder etwas dazwischen?
Die Kritik berührt ein zentrales Dilemma der Persönlichkeitspsychologie: Sollen wir in Typen oder in Dimensionen denken? Während viele klassische Persönlichkeitsmodelle – etwa das Big-Five- oder das HEXACO-Modell – auf kontinuierliche Dimensionen setzen, bieten Typenmodelle scheinbar eingängige Erklärungen: Menschen lassen sich klar einordnen, in Kategorien fassen, vergleichen.
Doch genau diese Vereinfachung ist gefährlich. „Typisierungen mit vier Buchstaben, Farben oder Symbolen helfen hier vermeintlich, schnell verschiedene Menschen voneinander zu unterscheiden“, so Ziegler (HU Berlin, 2019). Aber: Persönlichkeit ist kein starres Kategoriensystem, sondern ein kontinuierliches Spektrum individueller Unterschiede – mit fließenden Übergängen, nicht mit festen Schubladen.
Die methodische Demonstration von Kentaro et al. (2020) legt nahe, dass – trotz der Befunde von Gerlach et al. (2018) – weiterhin offenbleibt, ob sich Persönlichkeitstypen überhaupt nachweisen lassen.
Kein Werkzeug für wichtige Entscheidungen
Der Gedanke, Persönlichkeitstypen zur Grundlage von Entscheidungen – etwa im HR-Bereich – zu machen, wirkt daher zunehmend fragwürdig. Denn wenn die dazugehörigen Tests bei der Zuordnung nicht besser als ein Münzwurf sind, darf man ihnen in der Praxis keine entscheidende Bedeutung beimessen.
Ziegler betont daher: Auch bei Einsatz modernster Algorithmen und riesiger Datenmengen lassen sich stabile Persönlichkeitstypen nicht zuverlässig identifizieren. Die Gefahr von Fehlentscheidungen und falscher Etikettierung ist zu groß (HU Berlin, 2019).
Fazit
Die Idee von vier Persönlichkeitstypen ist attraktiv – aber wissenschaftlich höchst fragwürdig. Die Beiträge von Freudenstein et al. (2019) und Kentaro et al. (2020) zeigen eindrücklich: Wir sollten vorsichtig sein mit vermeintlich einfachen psychologischen Erklärungen.
Für alle, die mit Persönlichkeit arbeiten – ob in Forschung, HR oder Beratung – gilt:
Wissenschaftlich fundierte, dimensionale Modelle statt typisierender Schubladenlogik.
Denn Persönlichkeit ist komplex – und lässt sich nicht mit einem Würfelwurf verstehen, dazu braucht es psychologische Expertise.
Literatur
Freudenstein, J.-P., Strauch, C., Mussel, P. & Ziegler, M. (2019). Four personality types may be neither robust nor exhaustive. Nature Human Behaviour, 3, 1045–1046. https://doi.org/10.1038/s41562-018-0419-z
Gerlach, M., Farb, B., Revelle, W., & Nunes Amaral, L. A. (2018). A robust data-driven approach identifies four personality types across four large data sets. Nature human behaviour, 2(10), 735-742.
HU Berlin. (2019). Vorsicht bei Typentests – Tests zur Bestimmung von Persönlichkeitstypen sind so unsicher wie der Ausgang eines Münzwurfs. Presseportal. https://www.hu-berlin.de/de/pr/nachrichten/archiv/september-2019/nr-19926-1
Kentaro, K., Yoshihiko, K., Yuichi, Y., & Shinsuke, S. (2020). Commentary: A robust data-driven approach identifies four personality types across four large data sets. Frontiers in Big Data, 3. https://doi.org/10.3389/fdata.2020.00008