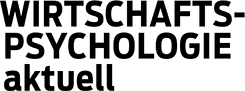Menschen verhalten sich mitunter widersprüchlich und werden unbewusst von Emotionen geleitet. Für Unternehmen, die ihre Produkte vermarkten und ihre Mitarbeitenden effektiv führen möchten, ist es daher wichtig, die verborgenen Dynamiken im menschlichen Verhalten zu verstehen. An genau diesem Punkt setzt tiefenpsychologische Marktforschung an.
Wenn Menschen sagen, was sie denken, und doch anders handeln
Im Alltag vieler Führungskräfte, HR-Verantwortlichen oder Markenstrateg*innen zeigt sich dasselbe Phänomen: Menschen verhalten sich anders, als sie es vorher angekündigt oder begründet haben. Mitarbeiter*innen befürworten offiziell Veränderungen und boykottieren sie dann still. Kund*innen sagen, dass ihnen Nachhaltigkeit wichtig ist, kaufen aber doch das günstigere Produkt.
Wir leben in einer Welt, die schnelle Antworten und klare Daten liebt. KI befeuert diesen Trend, indem sie Cluster, Daten und Trendanalysen liefert. Aber wissen Sie wirklich, warum Ihre Zielgruppe kauft – oder glauben Sie es nur zu wissen? Was motiviert Menschen in einer Welt, in der alles möglich scheint, die aber wenig Orientierung bietet?
Verhalten ist oft widersprüchlich, emotional aufgeladen und unbewusst geprägt. Wer wirklich verstehen will, was Menschen antreibt – im Konsum, im Unternehmen oder in Veränderungsprozessen –, braucht mehr als Messwerte. Er braucht Einsichten. Genau hier beginnt die Arbeit tiefenpsychologischer Marktforschung.
Warum das Unbewusste den Unterschied macht
In vielen Unternehmen gelten explizite Antworten noch immer als die höchste Form der Wahrheit. Dabei ist längst klar: Menschen wissen oft nicht, was sie wirklich denken – und denken nicht, was sie wirklich fühlen.
Tiefenpsychologische Marktforschung setzt genau hier an. User-Verhalten wird wesentlich durch unbewusste Motive, Ängste und innere Konflikte gesteuert. In der Konsumwelt zeigt sich das in irrationalem Kaufverhalten, scheinbar überzogenen Erwartungen an Marken oder dem Wunsch, durch Produkte Identität zu stiften (Dichter, 1991).
Für Führungskräfte, Coaches oder Markenverantwortliche bedeutet das: Wer diese verborgenen Dynamiken kennt, kann Kommunikation, Führung, Produktentwicklung oder Employer Branding auf ein neues Niveau heben – weil die Dynamiken plötzlich wirksam werden.
Methoden der tiefenpsychologischen Forschung
Die zentrale Methode sind qualitative Tiefeninterviews auf Basis der Morphologischen Psychologie. Diese Gespräche dauern bis zu 120 Minuten und verlaufen entlang der inneren Logik des Erzählens. Die Interviewführung ist dabei psychologisch geschult, verfolgt individuelle Assoziationen und macht unbewusste und widersprüchliche Bildwelten sichtbar, die rational oft nicht zugänglich sind (Fitzek, 1999).
Ergänzend werden Gruppendiskussionen, Alltagstagebücher sowie begleitende Beobachtungen im Lebens- und Arbeitsumfeld oder auch Social-Media-Analysen eingesetzt. Alle Verfahren zielen darauf, das Erleben zu erfassen – nicht nur das Verhalten. So zeigen sich Spannungsfelder zwischen bewussten Überzeugungen und unbewussten Sehnsüchten.
Anwendung in der Praxis: Drei Beispiele für tiefenpsychologische Perspektiven
Um die Einsatzmöglichkeiten und Methoden der tiefenpsychologischen Marktforschung zu verdeutlichen, werden im Folgenden drei Praxisbeispiele vorgestellt.
a) Konsument*innenverhalten entschlüsseln – Generation Alpha & Kosmetik
Warum beschäftigten sich Kinder mit Hautpflege, lange bevor ihre Haut diese Pflege braucht? In einer qualitativen Studie von innerSense Research zur Generation Alpha und Kosmetikverhalten zeigt sich: Für viele Kinder und Jugendliche sind Pflegeprodukte nicht nur Hygiene-Artikel, sondern Mittel zur Selbstermächtigung. Sie dienen als Ausdruck von Zugehörigkeit und Projektionsfläche für Ideale wie „cool sein“, „älter wirken“ oder „zu einer Community gehören“ (Hanisch, 2024a; 2024b).
Insight: Hinter der Produktnachfrage steckt ein Bedürfnis nach Orientierung und Identitätsbildung. Wer nur mit funktionalen Argumenten wie „sanfte Pflege“ oder „natürliche Inhaltsstoffe“ wirbt, verfehlt den emotionalen Kern. Tiefenpsychologie hilft hier, Produktentwicklung, Kommunikation und Zielgruppenansprache auf die tatsächlichen, oft unausgesprochenen Wünsche auszurichten.
b) Marken wirksam führen
In einer Kooperationsstudie der BSP Business & Law School und innerSense Research zur TikTok-Nutzung haben wir untersucht, wie junge Nutzer*innen Marken und Werbung auf der Plattform wahrnehmen und was sie unbewusst anzieht oder abstößt (Hinterding & Hanisch, 2025). Auffällig: Viele Marken investieren in aufwendige Kampagnen, doch die Clips wirken austauschbar. Die eigentliche Funktion von TikTok – einen Raum für Wünsche, Emotionen und Selbstinszenierung zu bieten – wird selten aufgegriffen.
Ein Beispiel: Ein Kosmetikhersteller wollte mit Hochglanzvideos punkten. Die Analyse zeigte aber: Was die Zielgruppe wirklich fasziniert, sind Erzählungen von Verwandlung, Selbstwirksamkeit und magischer Wunscherfüllung. TikTok wird nicht als Informationskanal, sondern als Bühne für „Mini-Märchen des Alltags“ genutzt. Marken, die dieses narrative Muster bedienen – etwa mit überraschenden Transformationen, authentischen Alltagsmomenten oder empowernden Self-Stories –, erzeugen echte Resonanz. Insight: Wer TikTok nur als weiteren Media-Kanal begreift, verfehlt seine psychologische Tiefenstruktur. Markenführung auf dieser Plattform bedeutet nicht „noch mehr Content“, sondern „emotionaler Resonanzraum statt Produktbotschaft“.
c) Emotionalität in der KI-Nutzung verstehen
Eine weitere tiefenpsychologische Studie der BSP Business & Law School und innerSense Research mit dem Titel „Ziemlich beste Freunde?“ (Hinterding & Hanisch, 2025) erwies: Viele erleben ChatGPT nicht nur als Tool, sondern als emotionalen Sparringspartner – als omnipräsenten und geduldigen Zuhörer. Dahinter stehen oft unbewusste Bedürfnisse: nach Resonanz, angstfreiem Ausprobieren oder Orientierung. KI hilft vielen dabei, eigene Gedanken zu sortieren, Entscheidungen zu strukturieren und sich in komplexen Situationen innerlich zu verorten – ganz ohne Druck von außen.
Insight: Der KI-Einsatz berührt psychologische Grundbedürfnisse – nach Beziehung, Struktur und innerer Ordnung. Wer das versteht, kann neue Formate für Coaching, Führung und Transformation entwickeln.
Vom Insight zur Umsetzung: Prinzipien tiefenpsychologischer Beratung
Tiefenpsychologie ist kein Selbstzweck. Sie folgt klaren Prinzipien:
- Analyse: Erfassen, was gesagt und was verdrängt wird.
- Hypothese: Identifizieren psychodynamischer Konfliktlinien.
- Reframing: Übersetzen der psychologischen Erkenntnisse, um Veränderungen erst möglich zu machen.
- Strategie: Ableitung konkreter Maßnahmen – für Marken, Führung oder Kommunikation.
Tiefenpsychologie liefert keine fertigen Antworten, sondern echte Hebel, um Verhalten zu verändern. Nicht durch Druck oder Manipulation, sondern durch Resonanz.
Quick Guide: 5 Fragen für mehr Tiefgang im Berufsalltag
Psychologisches Denken kann auch ohne Studien wirken. Nicht jede*r kann oder muss tiefenpsychologisch forschen, aber wir alle können Fragen stellen, die mehr aufdecken als nur Meinungen. Die folgenden fünf Fragen können helfen, in Gesprächen, Coachings oder Meetings unbewusste Subtexte zu erkennen und dank diesem Wissen bewusster zu agieren:
- Was wird gesagt – und was bleibt auffällig unausgesprochen?
- Was wird vermieden – sprachlich, thematisch, nonverbal?
- Welche Gefühle schwingen mit – bewusst oder zwischen den Zeilen?
- Welche inneren Bilder oder Rollen prägen mein Gegenüber (oder das Projekt)?
- Welche Widersprüche zeigen sich – und was könnten sie bedeuten?
Diese Fragen sind keine Diagnosen, aber sie öffnen Türen zu neuen Perspektiven.
Fazit: Warum tiefer sehen, weiterbringt
Unsere Zeit ist schnell, datengetrieben und faktenorientiert. Doch wer Verhalten verstehen will, braucht mehr als Zahlen. Tiefenpsychologische Marktforschung zeigt nicht nur was ist, sondern warum. Für alle, die Menschen erreichen wollen, nicht nur Märkte.