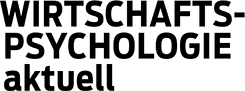Als die Geschäftsleitung des deutschen Handelskonzerns Otto den über 50.000 Mitarbeitern vor drei Jahren das Du anbot gab es heftige Diskussionen. Das Du diente seinerzeit als Startschuss für einen Modernisierungsschub. Es habe zu heftigen Diskussionen geführt, so Tobias Krüger, Bereichsleiter Kulturwandel 4.0 bei der Otto Group, in einem Gespräch mit der Neuen Zürcher Zeitung. Es gehe Otto dabei nicht darum zu duzen um des Duzens willen; vielmehr solle man das Du als ein äußeres Zeichen für einen inneren Wandel begreifen.
Duzen als Unternehmenskultur
Mittlerweile ist das Duzen Teil der Kultur in einer ganzen Reihe von Unternehmen auch im deutschsprachigen Raum geworden. Das Sie ist auf dem Rückzug. In internationalen Großfirmen, in denen die Konzernsprache schon immer Englisch gewesen ist und sich die Mitarbeiter mit dem Vornamen ansprechen, hat sich die Frage gar nie gestellt. Es sind denn auch vor allem Chefs, die aus dem angelsächsischen Raum stammen oder dort länger gearbeitet haben, die darauf drängen, die Du-Kultur einzuführen. – So geschehen z.B. bei der Swisscom und der SBB und der Basellandschaftlichen Kantonalbank, also in einer Branche, in der man das nicht erwartet hätte.
Duzen als Symbolpolitik?
Der Wirtschaftspsychologe Uwe Kanning von der Hochschule Osnabrück steht dem Trend eher skeptisch gegenüber. Seines Erachtens ist es zum einen eine Modeerscheinung, hat zum anderen aber auch mit dem Druck auf die Firmen zu tun, angesichts der zahlenmäßig kleiner werdenden Jahrgänge für Junge attraktiv zu sein. „Man will sein Image aufpolieren. Es besteht aber die Gefahr, dass dies reine Symbolpolitik bleibt. Die Kultur zu verändern, ist ein langer Prozess, weil die Manager auch anders führen müssen. Da ist mit dem Du allein noch nichts gewonnen“, sagt er.
Kanning hat gute Gründe zu bezweifeln, dass die Jungen das überhaupt wollen. In einer Umfrage aus dem Jahr 2017 unter 300 Studierenden sagten nur 41%, dass sie in Stellenanzeigen und in Bewerbungsgesprächen geduzt werden möchten. Wichtiger seien immer noch die «Basics» einer Stelle: Welchen Lohn erhalte ich, welche Arbeit ist zu erledigen – das Duzen kommt erst viel später.
Via Internet wurde von seinem Team im Jahr 2018 eine Befragung unter 1.300 Personen durchgeführt. Sie sollten das Duzen im Berufsleben auf einer Skala von 1 bis 4 – von stimme nicht zu bis stimme voll zu – bewerten. Das Duzen erreichte im Schnitt eine 2, das Siezen eine 1,5. Gegenüber einem reinen Siezen schneidet also das Duzen etwas besser ab. Die letzte Kategorie, bei der jeder selbst entscheiden kann, wen er siezt und wen duzt, erreichte mit 3,3 die größte Zustimmung.
Bewerber in Stelleninseraten besser Siezen
Kanning rät Firmen, in der die Du-Kultur herrscht, Bewerber in Stelleninseraten oder Anstellungsgesprächen dennoch nicht mit Du anzusprechen. „Die Bewerber sind ja noch Fremde, sie gehören nicht zum Klub. Auch der Bewerber selbst möchte vielleicht zunächst Distanz halten. Allerdings würde ich im Gespräch offenlegen, dass man sich in der Firma duzt. Die Person weiß dann, was sie erwartet.“ Firmen, die sich überlegen, auf das Du umzuschwenken, empfiehlt er, jetzt nicht einem Trend folgend neue Regeln aufzustellen. „Jeder Mitarbeiter soll selbst entscheiden, mit wem er per Du sein will oder per Sie. Hinzu kommt, dass es Branchen gibt, die ohnehin einen eher förmlichen Umgang pflegen, denken Sie etwa an das Bank- oder das Versicherungswesen.“ Dem Argument, das Duzen wirke einer Günstlingswirtschaft entgegen, in der es diejenigen gibt, die den Chef duzen, und die anderen, die das nicht tun, kann er nicht folgen. „Es gibt trotzdem Mitarbeiter, die den Chefs näher sind als andere. Man könnte genauso gut sagen, dass durch das Du diese Netzwerke verschleiert werden, weil alle so tun, als seien alle gleich.
Literatur
Kanning, U. (2018). Anders, aber nicht unbedingt besser – Wie Duzen in der Stellenanzeige das Image eines Arbeitgebers beeinflusst.
Eisenring, C. (2019, 19. Februar). Der Otto-Konzern nutzt das Du, um Hierarchien und Strukturen aufzubrechen. Neue Züricher Zeitung.