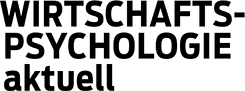Trotz aktueller konjunktureller Schwäche spüren viele Unternehmen den Fachkräftemangel deutlich. Eine scheinbar einfache Lösung: Quereinsteiger*innen einzustellen, obwohl diese nicht die für die freie Stelle übliche Qualifikation erworben haben. Quereinstiege haben in der Tat Potenzial für Personalgewinnung und Innovation, stellen aber besondere Anforderungen an die organisationskulturelle Integration der Mitarbeitenden.
Im ersten Quartal 2025 gab es in Deutschland 1,18 Millionen offene Stellen (Gürtzgen et al., 2025). Neben Maßnahmen wie Effizienzsteigerungen durch Digitalisierung, Ausbildungsoffensiven oder Anwerbung von internationalen Fachkräften bemühen sich Unternehmen und Verwaltungen zunehmend auch um Quereinsteiger*innen. Dieser Weg ist angesichts der steigenden Mobilität auf dem Arbeitsmarkt in allen Branchen vielversprechend: Einer Befragung von Stepstone zufolge denken 73 % der Beschäftigten mindestens einmal im Monat an eine neue Herausforderung, 84 % können sich auch einen Wechsel in eine andere Branche vorstellen. Auch hat sich die Anzahl von Stellenanzeigen auf der Plattform Stepstone, die sich an Jobsuchende mit fachfremdem Hintergrund wenden, von 2019 bis 2023 mehr als vervierfacht (329 %) (TheStepStoneGroup, 2024).
Weitergehende und berufsspezifische quantitative Analysen zum Quereinstieg liegen bislang nur in wenigen Feldern vor, sodass das gesamte Potential von Quereinstiegen nur schwer einzuschätzen ist. Am besten untersucht ist der Quereinstieg in das Lehramt (Dedering, 2020), wo der Anteil an Quereinsteiger*innen bundesweit bei mehr als zehn Prozent liegt (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2024).
Wer sind Quereinsteiger*innen?
Unter Quereinsteiger*innen verstehen wir Personen, die aus einer Branche in ein neues Betätigungsfeld wechseln, ohne eine dafür als üblich verstandene Qualifikation zu haben (Knecht, 2016).
Quereinstiege haben mehrere Funktionen:
- Gewinnung neuer Mitarbeitender,
- Wissenstransfer und Innovation durch heterogene Qualifikationen und Erfahrungen,
- bessere Problemlösefähigkeit durch intersektorale Zusammenarbeit.
Der Fokus der derzeitigen Diskussion liegt oft nur auf der Personalgewinnung und greift somit zu kurz.
Onboarding zur Integration in das neue Arbeitsfeld
Für Quereinsteigende ist Onboarding zur Orientierung besonders wichtig. Es können drei Ebenen unterschieden werden (Brenner, 2020):
- fachlich: Aneignung von Kenntnissen über Organisations- und Prozessstrukturen und von spezifischem Fachwissen
- sozial: Erschließen des neuen Arbeitsumfelds über soziale Kontakte, aktive Vernetzung mit Kolleg*innen und Vorgesetzten, Preboarding zum gezielten Aufbau von Bindungen
- kulturell: Kennenlernen der Ziele, Werte und Führungsgrundsätze des Unternehmens
Die Onboardingkonzepte sollten nach Zielgruppen unterscheiden, um den Einstieg von Quereinsteigenden treffsicher zu unterstützen. Um die Anzahl an Untergruppen für das Onboarding möglichst gering zu halten, können Quereinsteigende und Berufseinsteigende als Zielgruppe zusammengefasst werden, während Personen mit Berufserfahrung in der vorliegenden Branche eine eigene Gruppe bilden sollten (Selemann, 2025).
Beispiel: Quereinstieg in öffentlichen Verwaltungen
Die öffentliche Verwaltung ist ein interessantes Anschauungsbeispiel für Quereinstiege, da das Ausbildungssystem als sehr „geschlossen“ gilt und Quereinstiege bis vor wenigen Jahren kaum vorkamen. Für das Feld der öffentlichen Verwaltung ist die übliche Qualifikation die Verwaltungsfachangestelltenausbildung oder das verwaltungswissenschaftliche Studium. Personal wird für eine spezifische Laufbahn rekrutiert, die stufenweise durchlaufen wird und anhand spezifischer Regeln zum Einstieg, Aufstieg, Bezahlung und Altersversorgung ausgestaltet ist (Frevel, 2019).
Nach Schätzung des Beamtenbundes fehlen dem Staat derzeit 570.000 Beschäftigte (dbb, 2024). Laut Prognosen werden im Jahr 2030 etwa eine Million Fachkräfte im öffentlichen Sektor fehlen (PWC, 2022), mit negativen Folgen für das öffentliche Leben und die Lebensqualität in den Kommunen. Können Quereinsteiger*innen helfen, diese Herausforderung zu bewältigen?
In einer qualitativen Interviewstudie von Hammerschmid & Hustedt (2020) wurden 25 Quereinsteiger*innen, die als Führungskräfte in deutsche Verwaltungen gewechselt sind, zu ihren Motiven und Erwartungen befragt. Zudem wurden in Fallstudien in NRW anhand semi-strukturierter Interviews mit einer Personalleitung sowie mit 12 Beschäftigten in drei Kommunen die Bedarfe bei der Integration von Quereinsteiger*innen analysiert (Schäfer, 2025; Schiewer, 2025; Selemann, 2025). Diese Studien zielen nicht auf Repräsentativität ab, sondern nehmen explorativ eine erste Systematisierung des Feldes vor. Sie führten zu folgenden Ergebnissen:
Motive
Als Motivation zum Wechsel in die öffentliche Verwaltung wirken v. a. die Möglichkeit, einen sinnstiftenden Beitrag zum Gemeinwohl in der Gesellschaft zu leisten, sowie die interessanten und herausfordernden Stelleninhalte. Diese Motive werden sowohl von Führungskräften als auch von Sachbearbeitenden genannt. Ebenso gibt es die Erwartung, dass der öffentliche Dienst eine gute Work-Life-Balance ermögliche (Hammerschmid & Hustedt, 2020; Schäfer, 2025; Schiewer, 2025).
Manche quereinsteigende Sachbearbeiter*innen wechseln aus Unzufriedenheit mit der vorhergehenden Stelle in den öffentlichen Dienst, ohne über Detailwissen zur Verwaltungsarbeit zu verfügen (Schiewer, 2025). Da sie sich überzeugt zeigen, jederzeit in die Privatwirtschaft zurückkehren zu können (Schiewer, 2025), sollten öffentliche Arbeitgeber in ein gutes Onboarding investieren, um Quereinsteiger*innen zu binden.
Onboarding
Viele Verwaltungen entwickeln derzeit Onboardingkonzepte. Diese seien jedoch laut Quereinsteigenden sehr personenabhängig und oft nicht spezifisch auf Quereinsteigende zugeschnitten (Schiewer, 2025). Zum Onboarding gehört:
- Fachliche Integration: Sachbearbeitende zeigen oft eine große fachliche Unsicherheit und wünschen sich zielgerichtete Einführungsfortbildungen (Schiewer, 2025). Auch erfahrene Führungskräfte formulieren den Bedarf nach juristischer Expertise, die sie etwa durch kollegiale Beratung und Mentoren erhalten können (Hammerschmid & Hustedt, 2020).
- Soziale Integration: Als besonders hilfreich beschreiben Quereinsteigende auf allen Hierarchieebenen die Begleitung durch eine*n festen Mentor*in, mit dem bzw. der fachliche und kulturelle Unsicherheiten besprochen werden können (Hammerschmid & Hustedt, 2020; Selemann, 2025).
- Kulturelle Integration: Die Kultur der öffentlichen Verwaltung ist geprägt durch bürokratische Strukturen, hierarchische Dienstwege und dadurch oftmals langwierige Entscheidungsprozesse, was sowohl Führungskräfte als auch Sachbearbeiter*innen aus Wirtschaftsunternehmen als ungewohnt und negativ wahrnehmen. Als Herausforderung wurde auch eine mangelnde Akzeptanz und anfängliche Ablehnung der Quereinsteiger*innen durch die Veraltungsmitarbeitenden wahrgenommen (Hammerschmid & Hustedt, 2020; Schiewer, 2025). Daher ist neben dem Onboarding für die Quereinsteigenden auch eine Sensibilisierung für Vielfalt in der Gesamtorganisation erforderlich, z. B. durch Mitarbeitendengespräche oder Teamarbeit.
Tipps für die Integration von Quereinsteiger*innen
Folgende Lösungen für die Integration von Quereinsteigenden können abgeleitet werden:
- Transparente gegenseitige Erwartungen: Verwaltungen sollten durch Personalmarketing mehr Wissen über ihre Arbeitsweise an potenzielle Quereinsteigende kommunizieren und mithilfe von Befragungen die Erwartungen und Bedarfe von Quereinsteigenden besser verstehen.
- Systematische Onboardingkonzepte: Onboarding sollte zielgruppenspezifisch an die Bedarfe von Quereinsteigenden angepasst werden.
- Maßgeschneiderte fachliche Integration: Angesichts der heterogenen Berufsbiografien von Quereinsteigenden braucht es individuell zugeschnittene Weiterbildungen bzw. individuelle fachliche Begleitung.
- Schwerpunkt auf kultureller Integration: Die spezifische Arbeitskultur der Verwaltungsorganisationen erfordert insbesondere Maßnahmen zum kulturellen Onboarding. Dazu haben sich Patenmodelle und Preboarding bewährt.
Die vorliegenden empirischen Erkenntnisse zur Integration von Quereinsteiger*innen sind begrenzt und erfordern weitere Forschung. Die Strukturen sowie die Ausbildungswege von Verwaltungen sind bundesweit ähnlich, sodass die Deutungen der befragten Quereinsteiger*innen auch auf andere Verwaltungen weitgehend übertragbar sind.
Die im personalpolitischen Diskurs geäußerte Hoffnung, durch Quereinsteiger*innen das Fachkräfteproblem zu lösen, ist sicherlich zu optimistisch. Aus volkswirtschaftlicher Perspektive ist in erster Linie eine Umverteilung von Personal zu sehen, da der Quereinstieg kein Instrument ist, das den Personalpool als Ganzen erweitern kann. Der Vorteil von Quereinstiegen ist aber zweifellos, dass der Person-Job-Fit erhöht werden kann. Weiter bieten Quereinstiege das Potenzial, Personal vielfältiger aufzustellen und auf die gestiegene Mobilität von Mitarbeitenden zu reagieren.