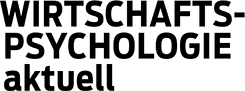Finanzentscheidungen im Unternehmen sind selten rein rational. Wer die psychologischen Dynamiken hinter Geld, Risiko und Motivation kennt, führt nachhaltiger, gesünder – und mit mehr Klarheit. Ein Beitrag mit konkreten Tipps und Beispielen aus der Praxis.
In der Gründungsphase eines Unternehmens steht meist die Idee im Mittelpunkt – nicht das Geld. Unternehmer*innen starten mit Motivation, Kreativität und Expertise. Doch bald spielen finanzielle Fragen eine zentrale Rolle. Wie viel Risiko bin ich bereit zu tragen? Was bedeutet Geld für mich persönlich? Welche Rolle spielt Geld für mein Unternehmen?
Finanzielle Entscheidungen sind nie rein rational. Sie sind eng mit der Persönlichkeit, der Beziehung zu Geld und der individuellen finanziellen Risikobereitschaft verknüpft. Diese ist ein relativ stabiles Persönlichkeitsmerkmal (Frey et al., 2017) – ein guter Kompass für finanzielle Entscheidungen.
Warum Geld mehr ist als Zahlen
Die persönliche Bedeutung von Geld ist strategisch entscheidend:
- Wer Geld mit Sicherheit verbindet, plant vorsichtiger, investiert bedächtiger.
- Wer Geld mit Freiheit assoziiert, geht mutiger voran – aber auch größere Risiken ein.
Die persönliche Einstellung zum Geld beeinflusst, wie Geschäftsideen umgesetzt, Preise kalkuliert und Investitionen priorisiert werden. Wer sich dieser Dynamik bewusst ist, steuert von Beginn an klarer und schützt sich vor Fehlentscheidungen. Besonders mutige Führungskräfte hinterfragen auch ihre Einstellung zu Geld bewusst, um für alle beruflichen und persönlichen Herausforderungen gewappnet zu sein.
Wenn Entscheidungen nicht zur Persönlichkeit passen
Viele Unternehmer*innen ignorieren jedoch ihre persönliche Risikobereitschaft – oft unbewusst (Müller, 2017). Das führt zu Stress, Fehlentscheidungen und einem Umfeld, das nicht zur Führungskraft passt (Hogan Assessment Systems. (o. J.).
Beispiel: Eine Person mit mittlerer finanzieller Risikobereitschaft nimmt einen hohen Kredit auf, weil „es schnell gehen soll“. Oder ein*e risikofreudige*r Gründer*in wird durch äußere Einschränkungen gezwungen, extrem sicherheitsorientiert zu handeln. Beides führt zu Spannungen – bei der Führungskraft selbst und im Team.
Die eigene finanzielle Risikobereitschaft bewusst zu reflektieren, hilft, realistische und gesunde Entscheidungen zu treffen. Das stärkt nicht nur die Unternehmensentwicklung, sondern auch die emotionale Stabilität aller Beteiligten.
Übung: Beantworten Sie und Ihre Kolleg*innen im Führungsteam unabhängig voneinander folgende Fragen: Wie risikobereit bin ich zwischen 0 und 10? (Beierlein, 2014) Was bedeuten diese Unterschiede oder Ähnlichkeiten für unsere Entscheidungen im Unternehmen?
Nehmen wir an: Die Personen haben eine sehr unterschiedliche Risikobereitschaft. Dann muss das Team überlegen, wie es den verschiedenen, nicht „wegdiskutierbaren“ Bedürfnissen Rechnung trägt. Ein in der Sache notwendiger Kompromiss verlangt meist von allen, einen Schritt aus der Komfortzone herauszutreten und mit Gefühlen wie Angst oder Ungeduld umgehen zu müssen. Sind sich die Personen sehr ähnlich, kann es zu gemeinsamen blinden Flecken kommen, z. B. wenn Menschen mit sehr hoher Risikobereitschaft ihre Kontrollmöglichkeiten überschätzen. Die jeweilige Risikobereitschaft ist weder gut noch schlecht. Bessere Entscheidungen basieren auf dem Bewusstsein dafür und der Entscheidung, wie das Team diese Faktoren berücksichtigt und Unterschiede idealerweise als Chance nutzt.
Finanzielle Vorurteile erkennen
Ein häufig unterschätzter Faktor ist geschlechtsspezifische Zuschreibung. Frauen wird oft unterstellt, risikoscheuer zu sein (Roszkowski & Grable, 2005), was laut Untersuchungen nicht stimmt (Morningstar Analytics, 2021). Trotzdem erhalten Frauen bei der Unternehmensfinanzierung seltener hohe Kredite (KfW, 2022), obwohl Studien zeigen, dass von Frauen geführte Unternehmen langfristig stabiler und erfolgreicher sind (KfW, 2023).
Eine bewusste Auseinandersetzung mit solchen Vorurteilen kann helfen, faire und fundierte Finanzierungsentscheidungen zu treffen – auf beiden Seiten des Verhandlungstisches.
Gehalt, Motivation und finanzpsychologische Dynamiken
Wächst ein Unternehmen, wächst auch die Herausforderung, neue Mitarbeitende zu gewinnen und fair zu entlohnen. Doch was ist „fair“?
In der Praxis zeigt sich: Geld allein motiviert nur kurzfristig. Wichtig ist, zu verstehen, welche Bedeutung Geld für verschiedene Personen hat. Unternehmer*innen verbinden Geld häufig mit Freiheit oder Unabhängigkeit, Mitarbeitende hingegen mit Sicherheit, Anerkennung oder Stabilität.
Ein bewährter Ansatz:
- Sprechen Sie im Unternehmen über Geld – und über seine Bedeutung.
- Berücksichtigen Sie Werte, Motive und Bedürfnisse im Umgang mit Risiken bei der Personalgewinnung.
- Nutzen Sie Tools wie Persönlichkeitsassessments, um passende Mitarbeitende zu finden.
So lassen sich Arbeitsbedingungen schaffen, die über Geld hinaus motivieren und langfristig binden.
Und nicht zuletzt: Wer finanzielle Unsicherheit und diffusen Geldstress im Unternehmen reduziert, stärkt Motivation, Gesundheit und Leistung. Denn ständiger Druck in Bezug auf Geld – ob bei Führung oder Mitarbeitenden – führt zu Anspannung, Erschöpfung und Fehlern. Ein gesundes finanzielles Umfeld trägt also auch präventiv zum Arbeits- und Gesundheitsschutz bei.
Projektionen auf Geld entlarven
Geld wird oft zum Platzhalter für unerfüllte Bedürfnisse, z. B. nach Sicherheit, Anerkennung, Macht. Wenn diese Projektionen nicht erkannt werden, entstehen Missverständnisse und Konflikte – in Teams, in Gehaltsverhandlungen, in der strategischen Ausrichtung.
Beispiel: Eine Gehaltserhöhung soll Anerkennung ausdrücken. Wenn sie nicht von echter Wertschätzung begleitet wird, verpufft der Effekt und es entsteht Frust.
Tipp: Führungskräfte, die ihre eigenen Projektionen erkennen und reflektieren, führen klarer und kommunizieren wirksamer.
Übung: Schreiben Sie eine kurze Biografie über Ihre Erfahrungen mit Geld. Beim Lesen entdecken Sie, welche Muster mit Geld in Ihrem Leben eine wichtige Rolle spielen.
Ein Beispiel: „Mit Geld zeigten mir meine Eltern ihre Wertschätzung.“ Wer das erlebt hat, wird als Erwachsener auch anderen Menschen ihren Wert über Geld signalisieren. Nicht-monetäre Wertschätzung fällt dann schwer. Den Job zu wechseln und dabei auf Gehalt zu verzichten, ist emotional kaum möglich. Die Gefahr, sich weniger wert zu fühlen, überwiegt.
Ein anderes weit verbreitetes Beispiel ist: „Mach dich nie abhängig von einem Mann und seinem Geld.“ Wer mit diesem Satz im Ohr die Karriereleiter erklimmen möchte, wird nie oben ankommen. Warum? Kaum jemand im Unternehmen ist abhängiger von anderen Männern und ihrem Geld als ein Top-Manager.
Das Auflösen all dieser Projektionen sollte schon früh zu den Mentoring-Programmen für angehende Führungskräfte gehören.
Vertrieb: Risikobereitschaft erkennen und sinnvoll nutzen
In der Vertriebsarbeit entscheidet oft die Persönlichkeit über den Erfolg.
Ein gezielter Umgang mit finanzieller Risikobereitschaft beim Gehalt im Vertrieb zahlt sich aus.
- Mitarbeiter*innen mit niedriger Risikobereitschaft → höheres Fixgehalt → Mitarbeiter*in holt sich Kraft aus der Stabilität und Sicherheit
- Mitarbeiter*innen mit hoher Risikobereitschaft → größerer Anteil an variabler Vergütung → Mitarbeiter*in holt sich Kraft aus der Flexibilität und dem Freiraum
Beide erreichen in diesen „Maßanzug“ ihr volles Potential. So fühlen sich alle im richtigen Spiel – und können zum Unternehmenserfolg beitragen, ohne sich selbst zu überfordern.
Stabilisierungsphase: Der unterschätzte Erfolgsfaktor
Nach der Wachstumsphase braucht jedes Unternehmen eine strategische Stabilisierungsphase. Sie wird oft übergangen – dabei ist sie entscheidend für langfristigen Erfolg.
Warum?
- Märkte schwanken – der Geldfluss auch.
- Innovation kostet zunächst Geld – jetzt ist weniger mehr.
- Kein Unternehmen kann ewig sprinten – Erfolg bedeutet Dauerlauf.
Wer Stabilität einplant und nicht dem Zufall überlässt, bleibt steuerungsfähig – auch in Krisen.
Führungskräfte, die nicht panisch auf Gewinneinbrüche reagieren oder euphorisch auf Umsatzsprünge, treffen klarere strategische Entscheidungen. Sie sind weniger abhängig von äußeren Entwicklungen und führen mit Weitblick.
Unternehmensnachfolge frühzeitig vorbereiten
Ein besonders sensibler Punkt: die Nachfolge. Oft wird sie zu spät geplant – oder emotional blockiert.
Mein Tipp aus der Praxis: Planen Sie Ihre Nachfolge schon in der Wachstumsphase mit. Fragen Sie sich:
- Wie führe ich heute, damit jemand mein Unternehmen gerne übernimmt?
- Was braucht mein*e Nachfolger*in, um erfolgreich weiterzumachen?
- Wie sichere ich meine Rente unabhängig vom Unternehmensverkauf?
Ein Unternehmen ist keine Altersvorsorge. Wer das versteht, verhandelt später souveräner – und sichert seine Unabhängigkeit.
Fazit
Finanzpsychologie ist ein unterschätzter Erfolgsfaktor in allen Phasen der Unternehmensführung. Wer seine eigenen Muster kennt, unbewusste Dynamiken reflektiert und finanzielle Gesundheit bewusst gestaltet, trifft klarere Entscheidungen – für sich selbst, das Team und die Zukunft des Unternehmens.