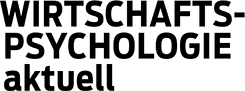Wer erfolgreich sein will, muss auch mit Niederlagen umgehen können, denn Scheitern ist ein wesentlicher Teil des Erfolgs. Wie lässt sich ein Arbeitsumfeld gestalten, in dem Mitarbeitende konstruktiv scheitern, aus ihren Fehlern lernen und dadurch ihre Leistung steigern?
Wenn wir nur auf Sicherheit spielen, verschenken wir Potenzial. Wir lernen nicht, mutig zu sein. Mut entscheidet aber oft über Gewinnen oder Verlieren. Meine These lautet: Für eine Kultur des Gewinnens braucht es eine Kultur des Verlierens.
Im Spitzensport wird dies besonders deutlich.
Roger Federer gewann in seiner Karriere über 80 % seiner Spiele und zählt damit zu den erfolgreichsten Tennisspielern aller Zeiten. Gleichzeitig konnte er – wie er 2024 in seiner Rede an der Dartmouth University betonte – nur rund 53 % aller gespielten Punkte für sich entscheiden. Mit anderen Worten: Selbst Federer verlor fast jeden zweiten Ballwechsel. Scheitern gehört auch auf Weltklasseniveau zum Alltag. Entscheidend ist nicht, jeden Fehler zu vermeiden, sondern den Fokus nach einem verlorenen Punkt sofort wieder auf den nächsten zu richten. Genau diese Fähigkeit unterscheidet konstante Spitzenleistung von kurzfristigem Erfolg.
Ähnliche Muster finden sich z. B. in der Wirtschaft, Literatur und im Film:
- Steve Jobs wurde 1985 aus dem eigenen Unternehmen Apple entlassen. Jahre später kehrte er zurück und machte es mit dem iPhone zur globalen Marke.
- J. K. Rowling erhielt zahlreiche Absagen von Verlagen, bevor „Harry Potter“ veröffentlicht wurde.
- Sylvester Stallone wurde von Studios mehrfach abgelehnt, weil man ihn als Hauptdarsteller für „Rocky“ nicht wollte – bis er das Drehbuch selbst umsetzte und damit Weltruhm erlangte.
Warum wir uns mit dem Scheitern befassen sollten
Empirische Befunde zeigen, dass psychologische Sicherheit für den Erfolg von Teams und Organisationen zentral ist. Die Harvard-Forscherin Amy Edmondson wies bereits in den 1990er-Jahren nach, dass Teams, die Fehler offen ansprechen, mehr lernen, innovativer handeln und langfristig bessere Ergebnisse erzielen als solche, in denen Mitarbeitende Angst haben, etwas Falsches zu sagen (Edmondson, 1999; Edmondson & Lei, 2014). Diese Erkenntnisse wurden seither vielfach bestätigt, u. a. in Studien zu Hochleistungsteams in Medizin-, Industrie- und Technologieunternehmen.
Innovation, unternehmerischer Mut und Leistung entstehen dort, wo Menschen bereit sind, Risiken einzugehen, obwohl sie scheitern könnten. Eine Organisation, die Scheitern nicht zulässt, wird auf Dauer stagnieren. Wenn Mitarbeitende hingegen lernen, Niederlagen als Teil des Prozesses zu akzeptieren, entsteht psychologische Sicherheit. Das bedeutet nicht, dass Fehler keine Rolle spielen oder Angst vollständig verschwindet. Psychologische Sicherheit beschreibt vielmehr ein Klima, in dem man ohne negative Konsequenzen für die eigene Stellung im Team offen über Fehler und Risiken sprechen, Fragen stellen und Unsicherheiten zeigen kann. In einem solchen Umfeld werden Lernen, Innovation und gegenseitige Unterstützung selbstverständlich und damit zu einer wesentlichen Grundlage für Spitzenleistung und Zusammenarbeit.
Die einleitenden Beispiele zeigen: Misserfolg ist nicht das Gegenteil von Erfolg, sondern oft seine Voraussetzung. Große Leistungen entstehen selten ohne vorherige Niederlagen. Gerade deshalb lohnt es sich, Scheitern als wichtigen Bestandteil von Entwicklung zu begreifen und auf diese Weise Kompetenzen zu entwickeln, um schöner scheitern zu können.
Schritt 1: Hinter die Fassade des Scheiterns blicken
Scheitern fühlt sich nicht nur wegen des Ergebnisses schwer an, sondern oft auch wegen unserer eigenen Bewertungen. Typische Faktoren sind (vgl. McComb et al., 2023; Kristof-Brown et al., 2023; Rybowiak et al., 1999):
- Vergleiche: Wer sich ständig misst, erlebt Niederlagen als doppelt hart.
- Hohe Erwartungen: Je höher der Anspruch, desto größer die Enttäuschung.
- Übermäßige Verantwortung: Wer Niederlagen als reine Selbstverschuldung interpretiert, trägt zu viel Last.
- Kontrollversuche: Der Wunsch, Unkontrollierbares wie Gedanken und Gefühle kontrollieren zu wollen, verstärkt das Gefühl des Scheiterns.
- Fehlende Wertepassung: Wenn ich etwas verfolge, das nicht zu meinen eigenen Werten passt, fühlt sich Scheitern besonders leer an.
Oft entsteht der Druck also nicht allein durch das Misserfolgsereignis selbst, sondern durch unseren inneren Widerstand dagegen. Wir wollen unangenehme Gefühle kontrollieren, vermeiden oder wegdrücken, und genau das verstärkt den Schmerz. Nehmen wir jedoch unsere Gefühle an, schaffen wir die Grundlage für einen konstruktiven Umgang mit dem Scheitern und öffnen den Weg für eine sachliche, lösungsorientierte Reflexion.
Schritt 2: Welche Kompetenzen brauchen Sie, um schöner zu scheitern?
a) Perspektivenwechsel
Oft belastet uns nicht das Scheitern selbst, sondern das, was wir darüber denken. Üben Sie, Distanz zu Ihren Gedanken zu schaffen, indem Sie diese als eine mögliche Deutung sehen, nicht als absolute Wahrheit.
Fragen Sie sich: Gibt es eine andere Sichtweise?
- Die Möglichkeit des Verlierens macht Gewinnen erst wertvoll.
- Wenn es Ihnen wehtut, zu scheitern, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass Ihnen das Ergebnis wichtig war.
b) Akzeptanz statt Kontrolle
Versuchen Sie nicht, unangenehme Gefühle zu verdrängen oder zu bekämpfen. Geben Sie Enttäuschung, Ärger oder Traurigkeit bewusst Raum. Akzeptanz heißt: Gefühle wahrnehmen, würdigen und anerkennen, auch wenn es schwerfällt.
c) Mythen über das Scheitern entzaubern
- Mythos: Es gibt eine einzige Ursache für mein Scheitern. Wahrheit: Meistens wirkt ein komplexes Zusammenspiel vieler Faktoren.
- Mythos: Ich allein bin schuld. Wahrheit: Fast immer gibt es eine Verkettung von Umständen.
- Mythos: Hinter jedem Scheitern steckt ein tiefer Sinn. Wahrheit: Manche Niederlagen führen zu Neuem, andere bleiben einfach schmerzhaft. Auch das gehört zur Realität.
d) Werteklarheit als Kompass
Scheitern stellt uns vor die Frage: Wer möchte ich sein?
Indem Sie sich auf Werte fokussieren, wird es einfacher, den Selbstwert vom Ergebnis zu entkoppeln. So wird weniger wichtig, was Sie erreichen, denn es zählt, wie Sie unterwegs sind. Werte geben Halt – auch nach Niederlagen.
e) Zusammen gescheitert: Debriefing als Schlüsselkompetenz
Nicht nur Einzelne, auch Teams, Projekte oder ganze Organisationen können an ihren Zielen vorbeigehen. Gerade dort zeigt sich, wie entscheidend der Umgang mit Misserfolg im Miteinander ist. Es reicht nicht, nur persönliche Kompetenzen zu entwickeln, um selbst flexibler und resilienter mit Niederlagen umzugehen. Ebenso wichtig ist die Fähigkeit, gemeinsam zu scheitern – also den offenen, respektvollen und lernorientierten Austausch über Fehler, Versäumnisse oder verpasste Chancen zu gestalten.
Ein Team, das kollektiv scheitert, steht vor einer doppelten Herausforderung: Einerseits gilt es, die emotionalen Reaktionen – Enttäuschung, Ärger, Frust – anzuerkennen. Andererseits braucht es eine klare Struktur, um aus der Situation zu lernen, ohne in Schuldzuweisungen oder Rechtfertigungen zu verfallen.
Hier setzt das Debriefing an. Es bietet einen Rahmen, um gemeinsam zu verstehen, was passiert ist, welche Faktoren eine Rolle spielten und wie man daraus lernen kann. Ziel ist nicht, Schuldige zu finden, sondern Muster zu erkennen und Verbesserungspotenzial zu nutzen. So wird ein Moment des Scheiterns eine Gelegenheit zur Weiterentwicklung – individuell wie kollektiv.
Ein strukturiertes Debriefing nach Niederlagen hilft, aus Fehlern zu lernen, ohne in Schuldzuweisungen zu verfallen. Wichtige Prinzipien sind (Keiser & Arthur, 2021; Sinek, 2019; Tannenbaum & Cerasoli, 2013):
- Den Rahmen für eine sachliche Fehleranalyse schaffen.
- Jede*r kommt zu Wort – Redezeit klar begrenzen.
- Lernchancen identifizieren und nutzen.
- Wiederholungsfehler konsequent abstellen.
- Nicht nach der einen Ursache suchen, sondern Zusammenhänge verstehen.
- Ergebnisse strukturieren und schriftlich festhalten.
Hilfreich ist es, sich gemeinsam folgende Fragen zu stellen:
- Was haben wir uns vorgenommen?
- Was ist passiert?
- Warum ist es passiert?
- Was können wir daraus lernen?
- Woran sollten wir jetzt arbeiten?
Fazit
Schöner scheitern heißt: Niederlagen annehmen, ohne sie zu verharmlosen. Es bedeutet, im Scheitern einen Hinweis auf Wertigkeit zu erkennen, denn nur Dinge, die uns wichtig sind, können uns überhaupt enttäuschen. Scheitern macht uns verletzlich, aber gerade diese Verletzlichkeit hält uns lebendig.
Wenn wir Akzeptanz üben, Beziehungen stärken, klug reflektieren und unsere Werte im Blick behalten, wird Scheitern nicht zum Stillstand, sondern zur Quelle von Wachstum.
Unser Blick auf das Scheitern kann sich verändern, wenn wir das Credo etablieren: Ich habe viel richtig gemacht, auch wenn ich verloren habe.
[Werbung] Der Autor hält am 11.11.2025 einen digitalen Vortrag zum Thema „Schöner scheitern“ im Rahmen der wirtschaftspsychologischen Fortbildungswoche der Deutschen Psychologen Akademie.