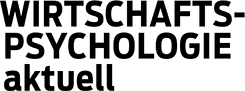Viele Arbeitnehmer*innen empfinden aktuell eine große Unsicherheit, da sie um angesichts der wirtschaftlichen Situation um ihren Job fürchten oder nur befristete Verträge erhalten. Diese Unsicherheit hat erheblichen Einfluss auf die Leistung, Arbeitszufriedenheit und Karrierechancen, wie eine aktuelle Meta-Analyse zeigt. Wie können Unternehmen reagieren?
Die wirtschaftliche Lage ist angespannt, auch in Deutschland verzeichnen Jobportale und Arbeitsagenturen einen Rückgang an Stellenangeboten im Vergleich zum Vorjahr (Beck, 2025) und der Anteil befristeter Arbeitsverhältnisse ist hoch (Emmler et al., 2024). Hinzu kommt die stetige Dynamisierung der Arbeitswelt aufgrund des technologischen Fortschritts, sodass Arbeitnehmende mehr denn je vor der Herausforderung stehen, ihre Beschäftigungsfähigkeit (Employability) zu erhalten (Hirschi & Koen, 2021).
Welche Folgen hat die Unsicherheit von Arbeitsplätzen für die Karrieren von Arbeitnehmenden? Wie wirkt sie sich auf die Karrierezufriedenheit, Karrierechancen, Beschäftigungsfähigkeit und das karrierebezogene Verhalten (z. B. Jobsuche) aus? Diese Fragen stehen im Zentrum einer aktuellen Meta-Analyse von Låstad et al. (2025), die auf 237 Primärstudien beruht und deren Ergebnisse in diesem Beitrag vorgestellt und diskutiert werden.
Was ist Arbeitsplatzunsicherheit?
Arbeitsplatzunsicherheit bedeutet, dass die Zukunft des aktuellen Arbeitsverhältnisses ungewiss erscheint (van Vuuren & Klandermans, 1990), ein potenzieller Jobverlust unfreiwillig wäre (Låstad et al., 2025) und man den eigenen Arbeitsplatz als weniger sicher empfindet, als man es sich wünscht (Hartley et al., 1991).
Aus früheren Metaanalysen ist bekannt, dass Arbeitsplatzunsicherheit mit einem höheren Risiko für körperliche Erkrankungen (Ferrie et al., 2016; Lang et al., 2012) und psychische Beschwerden (Kim & von dem Knesebeck, 2015; Llosa et al., 2018) einhergeht. Ebenfalls vielfach belegt sind negative Zusammenhänge mit der Arbeitsleistung (Sverke et al., 2019) und anderen arbeitsbezogenen Einstellungen und Verhaltensweisen (Cheng & Chan, 2008; Jiang & Lavaysse, 2018; Sverke et al., 2002). Folglich ist Arbeitsplatzunsicherheit nicht nur für einzelne Mitarbeiter*innen relevant, sondern auch für Unternehmen, die die Leistung der Angestellten abrufen möchten.
Meta-Analyse: Auswirkungen von Jobunsicherheit auf die Karriere
Um die Reaktionen von Menschen auf eine etwaige Bedrohung ihres Arbeitsplatzes zu verstehen, ziehen Låstad et al., (2025) die Theorie der Ressourcenerhaltung (Conservation of Resources, COR; Hobfoll, 1989; Hobfoll et al., 2018) heran. Die COR-Theorie postuliert, dass Menschen stets Ressourcen erwerben, erhalten und vermehren wollen. Gehen Ressourcen verloren, werden bedroht oder können trotz erheblicher Investitionen nicht erlangt werden, entsteht Stress. Zudem geht die COR-Theorie von vier Kernprinzipien aus:
- Negativity Bias: Ein Ressourcenverlust wird als negativer und folgenschwerer bewertet als ein Ressourcengewinn.
- Ressourceninvestition: Ein Ressourcenverlust kann verhindert werden, indem man Ressourcen aufwendet.
- Ressourcengewinn: Verliert man Ressourcen, strebt man nach neuen Ressourcen.
- Ressourcenschutz: Wer eigene Ressourcen bedroht sieht, versucht die verbleibenden Ressourcen zu schützen.
Übertragen auf einen drohenden Verlust des Arbeitsplatzes, der meist als bedrohlicher Ressourcenverlust eingestuft wird (Halbesleben et al., 2014), sind somit unterschiedliche Auswirkungen denkbar: Manche reagieren auf die Unsicherheit womöglich, indem sie durch Networking versuchen, in der Firma sichtbarer zu werden. Einige investieren hingegen in Weiterbildungen und wieder andere halten ihre vorhandene Expertise zurück, um unersetzbar zu sein (Shoss et al., 2023).
Um besser zu verstehen, wann es zu welchen Auswirkungen kommt, haben Låstad et al. (2025) folgende Variablen untersucht:

Ergebnisse
Die Arbeitsplatzunsicherheit war mit mehreren karrierebezogenen Faktoren verknüpft. Die signifikanten Korrelationen sind in der Tabelle durch Fettdruck und Sternchen hervorgehoben:

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Arbeitsplatzunsicherheit mit einer geringeren Karrierezufriedenheit und einer negativeren Wahrnehmung der eigenen Kompetenzen und Zukunftschancen einhergeht, während parallel die Absicht, den Beruf oder Arbeitgeber zu wechseln, deutlich zunimmt. Auch neigen Menschen, die ihren Job bedroht sehen, eher dazu, ihre Expertise zu verbergen, wohingegen langfristige karrierefördernde Aktivitäten wie Weiterbildung zurückgehen. Eine mögliche Begründung für das tendenziell geringere Investment in die eigene Weiterbildung ist laut Låstad et al. (2025), dass vermutlich der Fokus stärker auf kurzfristige als auf langfristige Karrierebemühungen gelegt wird. Dies kann jedoch in einer Abwärtsspirale münden, in der die Beschäftigungsfähigkeit und Weiterbildungsbereitschaft immer weiter zurückgehen.
Praktische Implikationen
Forschung zu Interventionen, mit denen Unternehmen die negativen Effekte von Arbeitsplatzunsicherheit senken könnten, ist erforderlich, um fundierte Handlungsempfehlungen abgeben zu können. An dieser Stelle sind daher lediglich begründete Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen der Meta-Analyse von Låstad et al. (2025) möglich:
- Gezielte Karriereförderung
Da Mitarbeitende bei Arbeitsplatzunsicherheit tendenziell weniger Zeit für Weiterbildung oder Karriereplanung aufwenden, sollten Unternehmen die Karriereförderung besonders im Blick behalten, z. B. durch individuelle Karrieregespräche, Weiterbildungsangebote und klare berufliche Perspektiven im Unternehmen. - Wissenskultur stärken
Die Neigung, bei Arbeitsplatzunsicherheit eigenes Wissen zurückzuhalten, ist der Produktivität und der Zusammenarbeit im Unternehmen nicht zuträglich. Daher sollten Unternehmen Teamziele in den Vordergrund stellen und psychologische Sicherheit fördern, z. B. durch eine konstruktive Fehlerkultur. - Maßnahmen gegen Fluktuationsabsichten
Unsicherheit steigert die Kündigungsabsicht. Mithilfe von regelmäßigen Check-ins als Frühwarnsystem können Unternehmen rechtzeitig von Kündigungsabsichten erfahren und gemeinsam mit den betreffenden Mitarbeitenden Lösungen finden. - Führungskräfte schulen
Führungskräfte sind Schlüsselfiguren in Unternehmen und ihr Umgang mit Unsicherheit wirkt sich auch auf die Belegschaft aus. Kompetenzen in Gesprächsführung und Change Management sowie emotionale Intelligenz sind daher im Kontext von tatsächlicher oder empfundener Arbeitsplatzunsicherheit essenziell.
Unternehmen, die Unsicherheit erkennen, ernst nehmen und aktiv begleiten, verhindern Demotivation, Abwanderung und Wissensverlust. Wichtig ist dabei, Klarheit und Perspektive zu geben, Ressourcen zugänglich zu machen und Engagement und Entwicklung weiter zu ermöglichen. Arbeitsplatzunsicherheit lässt sich zwar nicht immer vermeiden, doch Unternehmen sollten versuchen, sie zu managen, solange keine betriebsbedingten Kündigungen erforderlich sind.
Text von Isabelle Elena Bock