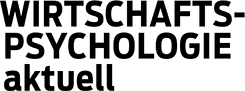Diskriminierung beginnt nicht erst im Vorstellungsgespräch – der erste Eindruck entsteht schon beim Blick auf die Bewerbung. Warum kann das Bauchgefühl unfair sein, wie behindern unbewusste Denkmuster Vielfalt und wie gestalten wir Auswahlprozesse möglichst diskriminierungsfrei?
Personalverantwortliche stehen in der Pflicht, faire und diskriminierungsfreie Entscheidungen zu treffen. Das ist durch das Gesetz vorgeschrieben, denn gesunder Menschenverstand allein reicht nicht aus. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) schützt Bewerbende in Deutschland vor Benachteiligung aufgrund sozialer Merkmale wie Geschlecht, ethnischer Herkunft oder sexueller Identität. Und doch kommt Diskriminierung weiterhin vor (Lippens et al., 2023), oft subtil und schwer erkennbar. Dies kann daran liegen, dass unsere Entscheidungen durch stereotype Bilder beeinflusst werden.
Der erste Eindruck ist selten neutral
Die Entscheidung, ob eine Person eingestellt wird, beginnt häufig mit dem Blick in die Bewerbungsunterlagen. Ist es z. B. ein Mann, eine Frau, eine nichtbinäre Person? Lässt der Name auf eine ausländische Herkunft schließen oder wird eine sexuelle Orientierung sichtbar? Solche Merkmale prägen die Fremdwahrnehmung und beeinflussen unbewusst unsere Urteile.
Oft glauben wir, diese Informationen hätten keinen Einfluss auf unsere Entscheidung. Doch Name, Foto oder Hinweise auf ein Ehrenamt können bereits Erwartungen auslösen, welche die Einschätzung der Persönlichkeit, der Kompetenz oder der Passung zum Beruf beeinflussen. Das Problem: In diesem Fall basiert die Eindrucksbildung nicht auf dem objektiven Vergleich von Qualifikationen, sondern auf Stereotypen.
Wenn Merkmale sich überschneiden: Diskriminierung im Doppelpack?
Wir alle gehören mehreren Kategorien an: Lässt sich Diskriminierung dann überhaupt auf ein einzelnes Merkmal zurückführen? Oft wirken mehrere Diskriminierungsformen gleichzeitig. Ein*e Bewerber*in kann etwa aufgrund des Geschlechts und der Herkunft benachteiligt werden. In der Wissenschaft nennt man das Intersektionalität („Kreuzung“). Diskriminierungen wirken nicht nur additiv, sondern überlagern sich (z. B. Ball et al., 2024; Cole, 2009). Eine 50-jährige Frau mit türkischstämmigen Namen erlebt andere Formen von Diskriminierung als eine 35-jährige Frau mit anscheinend deutschem Namen. Für Personalverantwortliche heißt das: Wer nur auf ein Merkmal blickt, übersieht zentrale Zusammenhänge. Ein Bewusstsein für Mehrfachdiskriminierung ist deshalb unerlässlich.
Diskriminierung hat viele Gesichter
Diskriminierung ist vielfältig: Sie kann offen oder subtil, bewusst oder unbewusst, freundlich formuliert oder verletzend sein. Diese Vielfalt macht sie schwer erkennbar. Umso wichtiger ist es, genau hinzuschauen, zuzuhören und sensibel für leise, aber wirksame Formen von Benachteiligung zu sein.
Ein Beispiel liefert eine Studie, in der gezeigt wurde, dass schwule und lesbische Bewerbende zwar ähnlich oft eingestellt wurden, auf subtiler Ebene jedoch Diskriminierung erlebten: Die Gespräche waren deutlich kürzer und weniger freundlich (Hebl et al., 2002).
Auch scheinbar wohlwollendes Verhalten kann diskriminierend sein, wie beim wohlwollenden Sexismus. Gegenüber Frauen wird Fürsorglichkeit suggeriert – beispielsweise wird eine Aufgabe als „vielleicht zu belastend“ angesehen, etwa für eine junge Mutter. Solche Aussagen wirken harmlos, transportieren aber klare Ausschlüsse. Zugespitzt lässt sich sagen: Auch wenn Frauen bei der Bewerbung die Tür aufgehalten wird, wird sie ihnen bei der Beförderung möglicherweise wieder verschlossen.
Ein weiteres Beispiel für subtile Diskriminierung ist der Similar-to-me-Effekt (Graves & Powell, 1995). Er beschreibt die Tendenz, Menschen zu bevorzugen, die einem ähnlich sind – im Auftreten, Lebensstil oder sozialem Hintergrund. Dieses „Vertrautheitsprinzip“ ist menschlich, aber besonders in Auswahlprozessen problematisch. Qualifizierte Personen, die nicht dem gewohnten Profil entsprechen, werden häufiger übersehen oder abgewertet (Hardy et al., 2022). Auf diese Weise reproduziert sich die bestehende Führungsebene immer wieder selbst. Ob man sich privat gut versteht, darf nicht zum heimlichen Auswahlkriterium für Führungspositionen werden.
Vorurteile wirken schon in der ersten Sekunde
Die Muster hinter Diskriminierung lassen sich durch Methoden, mit denen man genau hinschauen kann, sichtbar machen. So liefert z. B. die Methode des Eye-Trackings in unserer noch unveröffentlichten Studie „Bias in Sight“ neue Erkenntnisse. Teilnehmende beurteilten über 120 gleich qualifizierte Bewerbungsprofile, die sich lediglich in Merkmalen wie Geschlecht oder sexueller Orientierung unterschieden. Eye-Tracking zeigte, worauf sich die Aufmerksamkeit richtete, beispielsweise, ob Informationen zur sexuellen Orientierung bei manchen Personen länger betrachtet wurden, was auf eine kritischere Prüfung hindeuten kann. Tatsächlich zeigte sich: Wenn sich ein schwuler Mann für einen „männlich“ konnotierten Beruf bewarb, wurden die Angaben zur Qualifikation und Ausbildung deutlich genauer und länger geprüft als bei einem heterosexuellen Mann.
Doch nicht nur schwule Bewerber sind betroffen. Negative Beurteilungen können jede*n treffen, wenn stereotype Erwartungen verletzt werden. In unserer Studie wurden heterosexuelle Frauen seltener für „männlich“ konnotierte Berufe ausgewählt, und ihre Berufserfahrung wurde besonders lange geprüft. In einer früheren Studie wurden heterosexuelle Männer als weniger warm eingeschätzt im Vergleich zu schwulen Männern (Steffens et al., 2019). Dieses Urteil verringerte Einstellungschancen in weiblich konnotierten Berufen. Auch Ball et al. (2024) belegen: Je nach Kontext wurden mal deutsche, mal türkische Bewerberinnen negativer beurteilt. Das Lack-of-Fit-Modell (Heilman, 1983) bietet eine Erklärung: Wer nicht dem typischen Bild einer Rolle entspricht, gilt als weniger geeignet. Führung etwa wird oft mit „männlichen“ Eigenschaften verknüpft. Entspricht eine Frau (oder ein schwuler Mann) diesem Bild nicht, entsteht eine Passungsdifferenz, die negative Bewertungen begünstigt. Wer Diskriminierung verstehen will, sollte nicht nur auf die finale Entscheidung schauen – oft beginnt Diskriminierung schon in den ersten Sekunden.
Vielfalt ist mehr als ein Schlagwort
Alle Bewerbenden bringen individuelle Erfahrungen, Perspektiven und Lebensgeschichten mit. Diese Diversität ist eine Chance. Sie ermöglicht Unternehmen, flexibler zu reagieren und Bedürfnisse unterschiedlicher Kund*innen besser zu verstehen. Angesichts des Fachkräftemangels wird Vielfalt zur Notwendigkeit. Wer faire Rahmenbedingungen schafft, stärkt nicht nur sein Employer Branding, sondern bindet qualifizierte Mitarbeitende langfristig. Diskriminierung hingegen kostet Energie, Motivation, Gesundheit und Produktivität (Frohn & Heiligers, 2024). Vielfalt ist daher kein „Nice-to-have“, sondern ein entscheidender Erfolgsfaktor.
So gelingt diskriminierungsfreie Personalauswahl besser
Gegen Diskriminierung lässt sich aktiv etwas tun. Der erste Schritt ist Bewusstsein. Wer fair entscheiden will, muss eigene Denkmuster reflektieren. Strukturierte Auswahlverfahren mit klaren und einheitlichen Kriterien reduzieren subjektive Verzerrungen (Levashina et al., 2014). In frühen Phasen können anonymisierte Bewerbungen helfen, den Fokus auf Kompetenzen zu lenken.
Trainings zum Umgang mit Vorurteilen (z. B. „Unconscious-Bias-Trainings“) sensibilisieren Personalverantwortliche beim Erkennen stereotyper Denkmuster. Wichtig ist, dass solche Maßnahmen nicht einmalig bleiben, sondern dauerhaft in Führungsstrukturen und der Unternehmenskultur verankert werden. Zudem ist es sinnvoll, Stellenanzeigen inklusiv zu formulieren, Auswahlkriterien vorab festzulegen und auf Vielfalt unter Personaler*innen zu achten (Akay & Cheung, 2025; Horvath & Sczesny, 2016).
Auch ein Blick in die Forschung hilft: Wer wird eingeladen, wer befördert, wer verlässt das Unternehmen früh? Solche Auswertungen machen strukturelle Ungleichheiten sichtbar. Eine offene Feedbackkultur, transparente Entscheidungsprozesse und vielfältige Teams helfen, Diskriminierung nicht nur zu vermeiden, sondern aktiv abzubauen (Singh et al., 2013). Unternehmen, die solche Methoden einsetzen, schaffen nicht nur fairere Strukturen, sondern stärken auch das Teamklima, die Innovationskraft und ihre Position im Wettbewerb um Talente (Dutcher & Rodet, 2022; Jones et al., 2020).
Fazit
Diskriminierung in Bewerbungsprozessen kann mit einfachen Strategien vermieden werden: Stellenanzeigen inklusiv formulieren, Leitfäden für Gespräche nutzen, Kriterien vorher definieren und auf alle anwenden. Ein vielfältiges Auswahlgremium erhöht die Objektivität. Übergreifend ist Selbstreflexion entscheidend, um Vorurteile zu erkennen.
Wer seine Auswahlentscheidung regelmäßig hinterfragt, schafft Fairness und reduziert Diskriminierung und Ungleichheit.