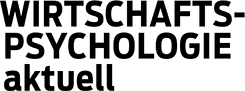Präsentismus bedeutet, trotz Krankheitsgefühl zu arbeiten. Die Tatsache, dass seit der Corona-Pandemie viel mehr Menschen im Homeoffice arbeiten als zuvor, wirft die Frage auf: Hat Präsentismus zugenommen? Und falls ja, wie können Unternehmen gegensteuern?
Vermutlich hören Sie auch immer wieder Unmut von Berufstätigen über den Druck, trotz Krankheitsgefühl zur Arbeit zu kommen, und über das Klagen von Personalverantwortlichen über zu hohe Fehlzeiten und „Blau machen“. Hier zeigt sich ein offensichtliches Spannungsfeld. Krankheitsbedingte Fehlzeiten und Präsentismus, also das Arbeiten trotz Krankheitsgefühl, sind Reizthemen im betrieblichen Umfeld. Nicht immer ist den Klagenden bekannt, dass sowohl Absentismus als auch Präsentismus betriebs- und volkswirtschaftlich hohe Kosten verursachen. Forschungen zeigen, dass insbesondere das Verhalten, trotz Krankheit zu arbeiten, langfristig mit schädlichen gesundheitlichen Folgen für die einzelnen Beschäftigten, mit Ansteckungen der Kolleg*innen und mit geringer Produktivität bei erhöhter Fehlerquote einhergehen kann (Skagen & Collins, 2016).
Spätestens seit der pandemiebedingten Verlagerung zahlreicher Arbeitsplätze ins Homeoffice stellt sich die Frage drängend und neu (Gerich, 2025): Wie verändert sich das Verhalten von Mitarbeitenden, die sich krank fühlen, wenn der Arbeitsplatz nicht mehr im Büro, sondern zu Hause liegt? Hat die Tendenz, trotz Krankheit zu arbeiten, durch die Ausweitung von Homeoffice eine neue Dynamik erhalten? Zeigt sich vermehrt Präsentismus?
Studie zu Präsentismus im Homeoffice
Das Forschungsteam unter Leitung von Mathilde Niehaus und Henrike Schmitz widmet sich systematisch der Frage, inwieweit Präsentismus im Homeoffice (Schmitz et al., 2023) und inwieweit Präsentismus speziell bei Mitarbeitenden mit chronischer Erkrankung (Projekt AmiChro, 2025) auftritt. Die Studien wurden als nicht-experimentelle Querschnittserhebung konzipiert. Wir berichten hier aus der ersten Studie (Schmitz et al., 2023). Die empirische Grundlage der vorgestellten Ergebnisse bildet eine quantitative Onlinebefragung von 233 Personen, die mindestens 60 % ihrer Arbeitszeit im Homeoffice verbringen. Für die Praxis der Personalführung und Organisationsentwicklung werden zentrale Impulse abgeleitet.
Die Befragungsergebnisse zeigen:
1. Präsentismus ist auch im Homeoffice häufig
Präsentismus ist auch im Homeoffice ein weitverbreitetes Verhalten. Rund 87 % der Befragten arbeiteten in einem Zeitraum von drei Monaten mindestens einen Tag trotz Krankheitsgefühl. Im Durchschnitt lagen 4,13 Präsentismustage vor.
2. Homeoffice begünstigt Präsentismus
Im Vergleich zur Präsenzarbeit empfanden die Befragten das Arbeiten trotz Krankheit im Homeoffice als deutlich einfacher (z. B. weil der Anfahrtsweg zum Büro wegfällt). Auch die Entscheidung gegen Präsentismus wurde im Homeoffice als schwieriger wahrgenommen. Das Homeoffice erleichtert Präsentismusverhalten somit nicht nur praktisch, sondern verändert wahrscheinlich auch die zugrundeliegende Bewertung der Schwelle zwischen Krankheit und Arbeitsfähigkeit (Ruhle et al., 2020).
3. Abschalten schützt vor Präsentismus
Ein zentrales Ergebnis ist der Zusammenhang zwischen Distanzierungsfähigkeit (Fähigkeit, sich nach Feierabend mental von der Arbeit zu lösen) und Präsentismus. Die Daten zeigen: Geringere Distanzierungsfähigkeit war mit einer höheren Anzahl an Präsentismustagen assoziiert. Auch wurde die eigene Fähigkeit zur Abgrenzung im Homeoffice schlechter bewertet als in der Präsenzarbeit. Die Tendenz, dass, wer schlechter abschalten kann, eher trotz Krankheitsgefühl weiterarbeitet, wird deutlich.
4. Unterstützung durch die Führungskraft
Je besser sich Beschäftigte durch ihre Führungskraft unterstützt fühlten, desto weniger Präsentismustage berichteten sie. Besonders relevant waren emotionale und ressourcenbezogene Unterstützung (wie Anerkennung, Ermutigung oder technische Ausstattung). Interessant ist: Im Homeoffice wurde die Unterstützung durch Führungskräfte signifikant schlechter bewertet als im Büro – insbesondere in Bezug auf Anerkennung und informellen Austausch.
Die häufigsten Gründe für Präsentismus im Homeoffice waren das Gefühl, „gesund genug“ zu sein, das Einhalten von Terminen und die Vermeidung von Ansteckung. Auch Pflichtgefühl und Kollegialität wurden vielfach genannt. Weitere Gründe waren Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber, der Wunsch, Kolleg*innen nicht zu belasten, sowie Unsicherheiten bezüglich Krankmeldungen im Homeoffice.
Mehr Präsentismus bei Mitarbeitenden mit chronischer Erkrankung
Die Situation von Mitarbeitenden mit chronischen Erkrankungen bedarf besonderer Aufmerksamkeit. Der Anteil von Beschäftigten mit chronischen Erkrankungen ist relativ groß. Ungefähr ein Drittel der Bevölkerung im Erwerbsalter hat eine chronische Erkrankung, die Erwerbstätigenquote bei Menschen mit chronischen Erkrankungen liegt bei rund 50% (BMAS, 2021, S. 231). Menschen mit chronischen gesundheitlichen Beeinträchtigungen berichteten durchschnittlich mehr Präsentismustage im Homeoffice als Personen ohne solche Einschränkungen. Allerdings zeigte sich kein signifikanter Unterschied im Präsentismus-Propensity-Score. Durch diesen Score wird eine Analyse des Entscheidungsverhaltens im Krankheitsfall losgelöst von der Häufigkeit der Krankheitsfälle ermöglicht, indem man die Anzahl der Präsentismustage in Verhältnis zu der Gesamtheit der Krankheitstage setzt. Das bedeutet auch, dass Beschäftigte mit Beeinträchtigungen viel häufiger vor der schwierigen Entscheidung stehen, ob sie trotz Krankheitsgefühl arbeiten. Die Befragungsergebnisse deuten darauf hin, dass Beschäftigte das Homeoffice tatsächlich als funktionales Arbeitsumfeld nutzen – etwa zur optimierten Selbststeuerung oder zur barrierearmen Erfüllung ihrer Aufgaben. Um besser zu verstehen, welche Arbeitsbedingungen funktional, unterstützend und passend sind, wird die aktuelle Onlinebefragung aus dem Jahr 2025 von 1.175 Beschäftigten mit chronischer Erkrankung, derzeit noch ausgewertet.
Wie auch aus anderer Forschung gehen aus den genannten Studien die Relevanz von Präsentismus im Homeoffice und Zusammenhänge von Präsentismus mit Distanzierungsfähigkeit deutlich hervor. Insbesondere die Gewohnheit, im Anschluss an die reguläre Arbeitszeit zur Kompensation der Arbeitslast noch im Homeoffice zu arbeiten, geht mit einer geringeren psychologischen Distanzierungsfähigkeit und einer erhöhten Neigung zu Präsentismus einher. Dies zeigt sich häufiger in Betrieben mit starker Wettbewerbsorientierung und gering formalisierten Homeoffice-Regeln (Gerlich, 2025). Die Studienlage spricht für eine grundsätzliche Sensibilisierung für das Thema „Arbeiten mit Erkrankung“, für die gezielte Weiterentwicklung von Führungskompetenz und für die Selbstregulation in mobilen Arbeitskontexten (Niehaus et al., 2023).
Was Personalverantwortliche und Unternehmen tun können
- Sensibilisierung für das Thema Arbeiten mit Erkrankungen (Orientierung bietet die Handlungshilfe AmiChro, die im November 2025 erscheint, Niehaus et al., 2023)
- Sensibilisierung für Präsentismus im Homeoffice: Das Thema sollte gezielt in Gesundheits-, Führungs- und Kommunikationsmaßnahmen integriert werden.
- Förderung von Distanzierungsfähigkeit: Klare Regeln zur (Nicht)Erreichbarkeit (z. B. feste Pausenzeiten) im Homeoffice sind hilfreich.
- Führung auf Distanz stärken: Führungskräfte sollten im Sinne indirekter, vertrauensbasierter Führung geschult werden, um Anerkennung, Transparenz und Unterstützung auch virtuell erlebbar zu machen.
- Monitoring etablieren: Die Zahl der Präsentismustage ist ein praktikabler Indikator, der in Mitarbeiterbefragungen aufgenommen werden kann.
Fazit
Die veränderte Bewertung von Krankheit im Homeoffice und die erschwerte Abgrenzung von der Arbeitsaufgabe bzw. Distanzierungsfähigkeit erfordern reflektierte Ansätze für eine gesundheitsförderliche Gestaltung der Arbeit. Dabei gilt es, Präsentismus nicht per se zu vermeiden, sondern zu differenzieren: Wann ist Präsentismus funktional und unterstützend, wann schädlich und riskant? Hier sind Führungskräfte von Beschäftigten mit gesundheitlicher Beeinträchtigung besonders gefordert.