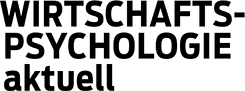Nach der Elternzeit erleben viele Beschäftigte, dass ihre Aufgaben an Anspruch verlieren. Was als Entlastung gedacht ist, kann zur Unterforderung führen – mit Folgen für Motivation, Selbstwert und Bindung. Der Beitrag zeigt, wie Organisationen Boreout erkennen und Rückkehrprozesse gestalten können.
Unterforderung als unterschätztes Risiko
Nach der Elternzeit erleben viele Rückkehrer*innen, dass ihre Zuständigkeiten reduziert oder vereinfacht werden. Was zunächst als Schutz vor Überlastung gedacht ist, kann in der Praxis zur strukturellen Unterforderung führen. Forschungsergebnisse zeigen, dass anhaltende Unterforderung vergleichbar belastende Effekte auf Motivation, Bindung und Wohlbefinden haben kann wie Überlastung (Harju et al., 2016; Kirazci et al., 2024; Maynard et al., 2006).
Im organisationalen Kontext wird Boreout als Zustand anhaltender Unterforderung beschrieben, in dem Arbeit ihre geistige Herausforderung und ihren Sinn verliert. Wer über längere Zeit zu wenig gefordert ist, zieht sich innerlich zurück – Motivation, Engagement und Leistungsbereitschaft nehmen ab (Harju et al., 2016; Stock, 2015).
Der Begriff Boreout ist kein klinisch definierter Begriff, sondern ein arbeitspsychologisches Phänomen, das zunehmend unter den Konzepten Arbeitslangeweile und Unterforderung erforscht wird. Schätzungen zufolge zeigen etwa 10 bis 15 Prozent der Beschäftigten Anzeichen einer solchen Unterforderung (Harju et al., 2016).
Für Personalverantwortliche und Führungskräfte heißt das: Entlastung darf nicht mit Entwertung verwechselt werden. Rückkehrgespräche sollten daher auch die qualitative Dimension von Aufgaben berücksichtigen und klären, was Mitarbeitende als fordernd und sinnstiftend erleben.
Passung statt Routine: Die psychologische Perspektive
Ob Arbeit als erfüllend oder ermüdend erlebt wird, hängt wesentlich von der Passung zwischen Person und Tätigkeit ab. Das Konzept des Person-Job Fit (Edwards, 1991) beschreibt diese Übereinstimmung zwischen Fähigkeiten, Bedürfnissen und Anforderungen. Fehlt die Passung, erleben Mitarbeitende Frustration und Entfremdung, selbst wenn die Arbeitsbedingungen angenehm erscheinen.
Fehlende Passung ist dabei selten rein individuell bedingt. Häufig resultiert sie aus strukturellen Routinen, etwa wenn Organisationen Rückkehrer*innen pauschal in vereinfachte Rollen zurückführen.
Empirische Befunde bestätigen die Folgen: Wer deutlich mehr kann, als gefordert wird, verliert Autonomiegefühl und Arbeitszufriedenheit (Maynard et al., 2006). Unterforderung geht zudem mit geringerer Bindung an die Organisation und erhöhter Fluktuationsneigung einher (Kirazci et al., 2024).
Arbeit bleibt langfristig nur gesund, wenn sie als verständlich, handhabbar und sinnhaft erlebt wird – so beschreibt es Antonovsky (1987) in seinem Konzept des Kohärenzgefühls. Fehlt dieser Sinnbezug, etwa durch monotone Tätigkeiten oder fehlende Verantwortung, entsteht ein psychologisches Ungleichgewicht – ein Nährboden für Boreout.
Für die Praxis bedeutet das: Führungskräfte sollten nicht nur Überlastung, sondern auch fehlende Herausforderung als Risiko erkennen. Regelmäßige Gespräche über Lern- und Gestaltungsbedürfnisse helfen, die Passung aktiv zu sichern.
Strukturelle Ursachen statt individueller Defizite
Unterforderung nach der Elternzeit ist selten persönliches Versagen, sondern oft Ausdruck organisationaler Routinen und implizierter Rollenbilder. Studien zeigen, dass insbesondere Mütter nach der Rückkehr häufiger Aufgaben mit geringerem Entscheidungsspielraum übernehmen (Bogusz, 2024). Teilzeitmodelle, Fürsorgeabsichten und stereotype Annahmen führen dazu, dass komplexe Tätigkeiten umverteilt werden – meist dauerhaft. Dadurch verlieren Rückkehrer*innen an Sichtbarkeit und Einfluss, während Organisationen wertvolle Kompetenzen ungenutzt lassen.
Gleichstellungspolitik bedeutet daher auch, Übergänge bewusst zu gestalten. Statt an früheren Rollen festzuhalten, sollten Personalentwicklung und Führung Rückkehrphasen als Lern- und Gestaltungsprozesse begreifen.
„Ich hatte das Gefühl, auf Standby zu laufen“ – Fallbeispiel aus der Praxis
Nach ihrer zweiten Elternzeit kehrt eine 38-jährige Projektleiterin in ihr Unternehmen zurück. Um sie zu entlasten, wird ihr Verantwortungsbereich reduziert, komplexe Projekte werden umverteilt. Anfangs dankbar, bemerkt sie bald ein wachsendes Gefühl von Unzufriedenheit, weil die Routineaufgaben dominieren und gleichzeitig Lernchancen fehlen. „Ich hatte das Gefühl, auf Standby zu laufen“, beschreibt sie rückblickend.
Erst als sie das Gespräch mit ihrer Führungskraft sucht und ihr Aufgabenprofil neu definiert wird, kehren Motivation und Selbstwirksamkeit zurück. Das Beispiel zeigt, wie schnell Unterforderung unbeabsichtigt entsteht und wie entscheidend frühzeitige Dialoge über Erwartungen und Entwicklungsmöglichkeiten sind.
Boreout-Prävention: Übergänge aktiv gestalten
Boreout lässt sich nicht durch mehr Beschäftigung lösen, sondern durch sinnvolle Beschäftigung. Organisationen können vorbeugen, indem sie Rückkehrprozesse systematisch gestalten:
- Rückkehrgespräche als strategischer Dialog: Nicht nur Stundenpläne, sondern Aufgabenprofile besprechen – welche Tätigkeiten fordern und motivieren?
- Aufgabengestaltung und Job Crafting: Mitarbeitende aktiv einbeziehen, um Aufgaben an Fähigkeiten und Interessen anzupassen (Harju et al., 2016).
- Mentoring und Reboarding-Programme: Rückkehrer*innen gezielt begleiten und ihre Sichtbarkeit sichern.
- Führung sensibilisieren: Nicht nur Überlastung, sondern auch Unterforderung als Gesundheitsrisiko verstehen.
Solche Maßnahmen fördern Lernfähigkeit, Motivation und Gleichstellung. Berufliche Übergänge können zu Chancen, statt Risiken werden.
Frühindikatoren für Unterforderung erkennen
Unterforderung kündigt sich selten laut an. Personalverantwortliche und Führungskräfte können auf folgende Anzeichen achten:
- Routinetätigkeiten dominieren und Lernchancen fehlen
- Beschäftigte wirken ruhig, aber innerlich distanziert
- Aussagen wie „Ich weiß gar nicht mehr, wofür ich das mache“ häufen sich
- Rückkehrer*innen übernehmen dauerhaft weniger Verantwortung als zuvor
- Eigeninitiative und Kreativität nehmen spürbar ab
Wer solche Signale früh erkennt, kann durch Dialog, Kompetenznutzung und gezielte Aufgabengestaltung rechtzeitig gegensteuern.
Fazit: Rückkehr als Chance
Boreout nach der Elternzeit ist kein individuelles Defizit, sondern Ausdruck mangelnder Passung und struktureller Routinen. Organisationen, die Rückkehrprozesse als psychologisch sensible Übergänge verstehen und sie aktiv gestalten, sichern Motivation, Bindung und Gleichstellung zugleich.
Führungskräfte können entscheidend dazu beitragen, indem sie Rückkehrer*innen in Entscheidungen einbinden und Aufgaben gemeinsam neu zuschneiden. So entsteht ein Verständnis von Fürsorge, das Entlastung ermöglicht, ohne Kompetenzen zu entwerten.
Wenn Arbeit wieder als sinnvoll und gestaltbar erlebt wird, wächst nicht nur individuelle Zufriedenheit, sondern auch die Organisation profitiert. Rückkehr kann Fortschritt bedeuten – für alle Beteiligten.