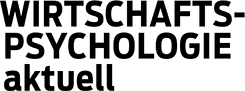Emotionen beeinflussen Kreativität, Zusammenarbeit und Leistung im Berufsalltag – oft, bevor sie bewusst wahrgenommen werden. Wer emotionale Reaktionen frühzeitig erkennt, ihre Bedeutung einordnen kann und einen konstruktiven Umgang findet, gewinnt Handlungssicherheit. In strukturierten Trainingsprogrammen kann emotionale Kompetenz gezielt für den beruflichen Alltag entwickelt werden.
Ein kritischer Blick im Meeting, eine unerwartete Rückmeldung oder eine überraschende E-Mail: Kleine Auslöser reichen oft aus, um Emotionen im beruflichen Umfeld hervorzurufen. Emotionen begleiten nahezu jede berufliche Situation und beeinflussen Leistung oder Kreativität (Fredrickson, 2001; Wan et al., 2022). Ein professioneller Umgang mit Emotionen bedeutet nicht, diese zu ignorieren, sondern sie als wertvolle Informationsquelle zu verstehen und somit handlungsfähig zu bleiben.
Die Bedeutung emotionaler Kompetenzen
Emotionale Intelligenz wurde von Salovey und Mayer (1990; vgl. auch Mayer et al., 2008) als die Fähigkeit beschrieben, Emotionen wahrzunehmen, zu verstehen, sinnvoll zu nutzen und angemessen zu beeinflussen. Emotionale Kompetenz wird in der Literatur oftmals als die praktisch anwendbare Umsetzung dieser Fähigkeiten im konkreten Handlungsfeld verstanden (Goleman, 1995; Kotsou et al., 2011). Während emotionale Intelligenz häufig als kognitive Fähigkeit eingeordnet wird, zielt emotionale Kompetenz stärker auf deren Anwendung im Alltag.
Studien zeigen Zusammenhänge zwischen emotionaler Kompetenz, differenzierter Situationsbewertung, konstruktiver Konfliktgestaltung und Stressresistenz (z. B. Martins et al., 2010). Teams profitieren von einem bewussten Umgang mit Emotionen durch mehr Vertrauen, eine offenere Kommunikation und weniger Missverständnisse (Barsade & O’Neill, 2014; Jordan & Troth, 2004). Die Forschung weist zudem darauf hin, dass emotionale Kompetenz insbesondere in Führungsrollen und bei der Zusammenarbeit im Team, im Kundenkontakt und in beratenden Tätigkeiten die Wirksamkeit sozialer Interaktionen fördert (Clarke, 2010; Humphrey, 2013). Damit ist emotionale Kompetenz nicht lediglich eine „weiche“ Zusatzqualifikation, sondern ein essenzieller Bestandteil professioneller Selbstführung und Zusammenarbeit im beruflichen Kontext.
Emotionale Kompetenzen lassen sich gezielt stärken
Studien legen nahe, dass emotionale Kompetenzen durch Trainings weiterentwickelt werden können. In einer Untersuchung von Kotsou et al. (2011) schätzten Teilnehmende nach einem strukturierten Kompetenzprogramm ihre emotionale Handlungsfähigkeit, als verbessert ein. Eine Meta-Analyse von Hodzic et al. (2018) weist darauf hin, dass entsprechende Trainings besonders dann wirksam sind, wenn sie theoriegeleitet aufgebaut und erfahrungsbasiert durchgeführt werden. Diese Befunde legen nahe, dass emotionales Handeln im beruflichen Umfeld nicht ausschließlich auf persönlichen Voraussetzungen beruht, sondern durch geeignete Lern- und Entwicklungsprozesse gestärkt werden kann.
Orientiert am Fähigkeitsmodell von Salovey und Mayer (1990) lassen sich vier Bereiche emotionaler Kompetenz unterscheiden: Wahrnehmen, Verstehen, Nutzen und Regulieren von Emotionen. Aus diesen Kompetenzbereichen können praxisorientierte Strategien für den beruflichen Umgang mit Emotionen abgeleitet werden.
Wahrnehmen:
Das präzise Benennen von Emotionen („Ich bin verunsichert“ statt „Ich fühle mich schlecht“) verbessert Ihre Selbstwahrnehmung und unterstützt die Emotionsregulation. Studien zeigen, dass emotionale Zustände als weniger intensiv empfunden werden, wenn man sie mithilfe einer differenzierten Sprache genau benennt (Lieberman et al., 2007). Ein breites Emotionsvokabular stärkt Ihre Fähigkeit, Emotionen differenziert zu erkennen und richtig einzuordnen (Barrett, 2017). Achtsamkeit kann diesen Prozess fördern, indem Sie lernen, innere Signale bewusst wahrzunehmen, bevor diese Ihr Handeln beeinflussen (Hülsheger et al., 2013).
Verstehen:
Emotionen geben Aufschluss über Werte, Ziele und Bedürfnisse einer Person (Frijda, 1986; Scherer, 2005). Gemäß der emotionsfokussierten Theorie von Greenberg (2011) können wir folglich Emotionen als adaptive Signale verstehen, die uns Orientierung geben. Wenn Sie Emotionen hinsichtlich ihrer Funktion einordnen können – etwa Ärger als Hinweis auf ein Gerechtigkeitsbedürfnis oder Angst als Ausdruck von Unsicherheit –, können Sie berufliche Situationen differenzierter einschätzen.
Nutzen:
Positive Emotionen stehen laut der Broaden-and-Build-Theorie von Fredrickson (2001; 2003) im Zusammenhang mit erweitertem Denken und Handeln sowie dem Aufbau psychologischer und sozialer Ressourcen. Sie fördern Offenheit, Kreativität und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit – wichtige Faktoren für Problemlösung und Teamdynamik im Arbeitsalltag. Wenn Sie beispielsweise Zuversicht oder Freude erleben, fällt es Ihnen leichter, neue Perspektiven einzunehmen, kreative Ideen zu entwickeln oder auf andere zuzugehen.
Zugleich lohnt es sich zu reflektieren, in welchen Situationen im Arbeitsalltag auch eher unbeliebte Emotionen hilfreich sein können und welche Handlungen sich aus ihnen konkret ableiten lassen. So kann z. B. Ärger die erforderliche Energie freisetzen, um mutig Dinge anzusprechen oder notwendige Veränderungen anzustoßen (Frijda, 1986; Lazarus, 1991; Scherer, 2005).
Regulieren:
Ein konstruktiver Umgang mit Emotionen bedeutet, diese bewusst zu gestalten, statt ihnen unreflektiert zu folgen. Besonders wirksam sind Strategien wie die kognitive Neubewertung („reappraisal“). Wenn Sie eine Situation neu deuten – etwa eine kritische Rückmeldung als Lernchance begreifen –, bleiben Sie handlungsfähig und souverän. Studien zeigen, dass Personen mit hoher Regulationsfähigkeit mehr berufliche Zufriedenheit und eine geringere Belastung erleben (Harms & Credé, 2010).
Theorie allein reicht nicht aus
Neben dem Wissen über die psychologischen Grundlagen von Emotionen und emotionaler Intelligenz ist das erfahrungsorientierte Erlernen emotionaler Kompetenzen unverzichtbar. Insbesondere in Gruppenlernformaten – z. B. im Rahmen von strukturierten Trainingsprogrammen – erleichtern Perspektivwechsel und der Austausch von Erfahrungen das Verständnis und die Anwendung emotionaler Kompetenzen passend zur beruflichen Rolle oder Situation.
Fazit
Wissenschaftliche Modelle zur emotionalen Intelligenz bieten eine Grundlage, aus der sich praxisorientierte Methoden zur Stärkung emotionaler Kompetenz entwickeln lassen. Eine differenzierte Wahrnehmung, Reflexion und bewusste Regulation Ihrer Emotionen helfen Ihnen dabei, in anspruchsvollen beruflichen Situationen reflektierter und zielgerichteter zu handeln (vgl. Mayer et al., 2008).
[Werbung]
Am 11. und 12. November leitet die Autorin im Auftrag der Deutschen Psychologen Akademie ein Seminar zum Training emotionaler Kompetenzen. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie hier.