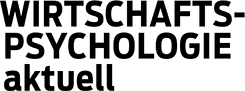Emotionale Intelligenz gehört zu den meistgenannten Kompetenzen, wenn es um erfolgreiche Führung oder gesunde Teams geht, doch die wissenschaftliche Befundlage ist komplexer als oft angenommen. Eine aktuelle Studie im „Consulting Psychology Journal“ zeigt: Emotionale Intelligenz ist nicht bedingungslos positiv, sondern kann in bestimmten Kontexten zur Belastung werden.
Emotionale Intelligenz (EI) bezeichnet die Fähigkeit, Emotionen bei sich selbst und anderen wahrzunehmen, zu verstehen, produktiv zu nutzen und zu regulieren (Salovey & Mayer, 1990). Das Konzept umfasst vier Kernbereiche: Emotionswahrnehmung, Emotionsverständnis, Emotionsnutzung und Emotionsregulation (Emmerling & Cherniss, 2025).
Wichtig ist: EI wird als entwickelbare Fähigkeit verstanden – nicht als fixes Persönlichkeitsmerkmal. Wie gut und nachhaltig EI trainiert werden kann, ist laut Emmerling und Cherniss (2025) allerdings noch nicht abschließend geklärt.
Die Befunde aus zwei aktuellen Studien
Studie 1: EI in der Führungskräfteauswahl
Palmer und Lee (2025) untersuchten 485 anstrebende Schulleiter*innen. Zum einen wurde die klassische Führungsperformance anhand von 47 Leistungsindikatoren bewertet, z. B. wie gut jemand den Unterricht weiterentwickelt, Mitarbeitende fördert oder Veränderungsprozesse steuert. Zum anderen wurde die emotionale Intelligenz der anstrebenden Schulleiter*innen von ihnen selbst und von je sechs Personen aus ihrem Arbeitsumfeld bewertet. Zusätzlich bewerteten diese Kolleg*innen, wie gut die Person mit anderen zusammenarbeitet und wie gut sie insgesamt ihre Arbeit macht.
Das zentrale Ergebnis: 17% der Unterschiede in der Qualität der Interaktionen und 8% der Unterschiede in der Gesamtarbeitsleistung lassen sich auf Unterschiede in der EI der Personen zurückführen – über traditionelle Führungskompetenzen hinaus. Das bedeutet konkret: Von zwei Führungskräften mit ähnlicher Fachkompetenz und Erfahrung wird die Person mit der höheren emotionalen Intelligenz mit höherer Wahrscheinlichkeit bessere Beziehungen aufbauen und effektiver führen.
Ein weiterer wichtiger Befund: Selbsteinschätzungen von EI sagen kaum etwas über Führungserfolg aus, während Fremdbeurteilungen sehr aussagekräftig sind (Palmer & Lee, 2025). Dies spricht für die Verwendung von 360°-Feedbacks statt Selbstberichten in der Leistungsbewertung.
Zudem zeigten Palmer und Lee (2025): 70 anstrebende Schulleiter*innen mit anfänglich niedriger EI verbesserten nach einem sechswöchigen Entwicklungsprogramm ihre EI-Werte um durchschnittlich 43 Prozentpunkte. Dies deutet darauf hin, dass EI trainierbar ist – zumindest auf der Ebene des beobachtbaren Verhaltens.
Studie 2: EI als Risikofaktor?
Kusik et al. (2025) untersuchten 374 polnische Pflegekräfte: Wie wirkt sich EI auf das berufliche Wohlbefinden aus, wenn Menschen ihre wahren Gefühle verbergen und andere Emotionen vortäuschen müssen? Dieses „Surface Acting“ – das oberflächliche Schauspielern von Emotionen – ist in vielen Berufen Alltag.
Der überraschende Befund: Pflegekräfte mit höherer EI, die häufig ihre Emotionen vortäuschen müssen, zeigen stärkere Burnout-Symptome und geringere Arbeitszufriedenheit als Kolleg*innen mit niedrigerer EI. Für Personen mit niedriger EI macht es weniger einen Unterschied, ob sie viel oder wenig schauspielern müssen (Kusik et al., 2025).
Warum? Möglicherweise, weil emotional intelligente Personen die Diskrepanz zwischen echten und gezeigten Emotionen deutlicher erkennen. Sie merken: „Ich bin erschöpft, aber ich lächle trotzdem.“ Diese erhöhte Selbstwahrnehmung führt zu einem stärkeren Erleben von Unechtheit – und das ist belastender. Personen mit niedrigerer EI bemerken diese Diskrepanz weniger, was sie paradoxerweise schützt (Kusik et al., 2025).
Der Kontext entscheidet
Beide Studien zeigen: In Situationen, die authentisches Verhalten wie transformationale Führung ermöglichen, ist hohe EI vorteilhaft (Palmer & Lee, 2025). In Situationen, die unechtes Verhalten erzwingen, kann hohe EI zum Risikofaktor werden (Kusik et al., 2025).
Diese Befunde hinterfragen die pauschale Annahme, dass „mehr emotionale Intelligenz immer besser“ sei. Stattdessen ist EI eine kontextabhängige Kompetenz mit potenziellen Schattenseiten.
Methodische Einschränkungen der Studien
- Keine kausalen Aussagen: Palmer und Lee (2025) betonen, dass ihre Querschnittsdaten nicht klären können, ob hohe EI zu Führungserfolg führt oder ob erfolgreiche Führungskräfte durch ihre Erfahrung mehr emotionale Intelligenz entwickeln. Die Wirkrichtung bleibt unklar.
- Verzerrungen durch „Halo-Effekt“: Palmer und Lee (2025) diskutieren, dass Fremdbeurteilungen verzerrt sein könnten und beliebte Führungskräfte möglicherweise in allen Bereichen positiver bewertet werden, unabhängig von ihrer tatsächlichen EI.
- Umgekehrte Wirkrichtung: Kusik et al. (2025) weisen darauf hin, dass auch die umgekehrte Kausalität denkbar ist – bereits erschöpfte Personen neigen möglicherweise mehr zu Surface Acting, weil ihnen die Energie für authentisches Verhalten fehlt.
- Begrenzte Generalisierbarkeit: Kusik et al. (2025) betonen, dass ihre Stichprobe ausschließlich weiblich und auf polnische Pflegekräfte begrenzt ist, was die Übertragbarkeit auf andere Berufsgruppen, Geschlechter und Kulturen einschränkt. Palmer und Lee (2025) haben auch nur anstrebende Schulleiter*innen untersucht, was ebenfalls die Generalisierbarkeit einschränkt.
- Bedarf an experimentellen Studien: Beide Forschungsteams fordern Längsschnittstudien und experimentelle Designs mit Kontrollgruppen, um Kausalität eindeutig nachzuweisen. Emmerling und Cherniss (2025) verweisen zwar auf vereinzelte Langzeitstudien (z. B. Rode et al., 2017), die zeigen, dass EI spätere berufliche Erfolge vorhersagt, dennoch bleibt der Forschungsbedarf bestehen.
Was bedeutet das für die Praxis?
Für Führungskräfteauswahl und -entwicklung
- 360°-Assessments statt Selbstberichte nutzen: Lassen Sie Führungskräfte von Mitarbeitenden, Kolleg*innen und Vorgesetzten einschätzen – Fremdbeurteilungen sind deutlich aussagekräftiger (Palmer & Lee, 2025). Kombinieren Sie dies mit strukturierten Verhaltensinterviews: „Beschreiben Sie eine Situation, in der ein Teammitglied emotional aufgebracht war. Wie haben Sie reagiert?“ Wichtig: Betrachten Sie EI als Ergänzung, nicht als Ersatz zur Fachkompetenz.
- Wirksame Entwicklungsformate gestalten: Bieten Sie zeitlich verteilte Trainings mit Praxisübungen (z. B. Rollenspiele zu schwierigen Personalgesprächen), Feedback und konkreten Übungen zwischen den Sessions an – nicht One-Shot-Workshops (Hodzic et al., 2018; Mattingly & Kraiger, 2019). Etablieren Sie Peer-Learning-Gruppen, in denen sechs bis acht Führungskräfte monatlich über emotionale Herausforderungen sprechen. Setzen Sie realistische Erwartungen: Die 43%-Verbesserung bei Palmer und Lee (2025) entstand durch ein 6-Wochen-Programm mit Coaching, nicht durch ein Tagesseminar.
Für Gesundheitsschutz in emotional fordernden Berufen
-
Authentizität in Verhaltensrichtlinien ermöglichen: Formulieren Sie starre Regeln wie „Als Servicemitarbeitende müssen Sie immer lächeln“ um: „Bleiben Sie professionell und respektvoll“. Erlauben Sie situationsangemessenes statt standardisiertes Verhalten: Statt „Ich verstehe Ihren Ärger“ (unecht) „Ich nehme wahr, dass Sie verärgert sind. Lassen Sie mich schauen, wie ich helfen kann.“ Emotional intelligente Mitarbeitende leiden besonders unter erzwungenem Verhalten, möglicherweise weil sie die Diskrepanz zu ihren echten Gefühlen bewusster wahrnehmen (Kusik et al., 2025).
- Strukturelle und individuelle Ebene adressieren: Regelmäßige Supervisionsgruppen oder kollegiale Fallbesprechungen schaffen Raum für emotionale Entlastung. Führungskräfte sollten sensibel sein für Warnsignale bei emotional intelligenten Mitarbeitenden wie Rückzug, Zynismus oder Äußerungen wie „Ich kann nicht mehr so tun als ob“. Wichtig: EI-Training löst keine strukturellen Probleme wie Personalmangel oder Arbeitsverdichtung – arbeiten Sie parallel an beiden Ebenen (Kusik et al., 2025).
Für Team- und Organisationskultur
- Emotionales Feedback und Reflexion etablieren: Ergänzen Sie Sachfeedback um emotionale Ebenen: „Ich habe die Zusammenarbeit als wertschätzend erlebt“ oder „Die Stimmung im Meeting wirkte angespannt – wollen wir darüber sprechen?“ Bauen Sie in Retrospektiven feste Reflexionsfragen ein: „Was hat uns als Team Energie gegeben oder gekostet?“ Seien Sie als Führungskraft ein Vorbild für Emotionsregulation: „Die Umstrukturierung hat auch mich verunsichert. Lasst uns gemeinsam schauen, wie wir damit umgehen.“ So erscheint Emotionsregulation als Professionalität, nicht als Schwäche.
Fazit
Emotionale Intelligenz ist kein Erfolgsgarant, sondern ihre Wirkung hängt vom organisationalen Kontext ab. Während EI in authentizitätsfördernden Umgebungen Vorteile bringt, kann sie in stark reglementierten Arbeitssituationen zur zusätzlichen Belastung werden. Der Arbeitskontext ist damit ebenso relevant wie die individuelle EI.
Für die Praxis heißt das: Es lohnt sich, EI systematisch zu berücksichtigen – in Auswahlverfahren, in Entwicklungsprogrammen, und v. a. in der Gestaltung von Arbeitsbedingungen, die authentisches Verhalten ermöglichen. Emotionale Intelligenz ersetzt nicht gute Arbeitsbedingungen oder fachliche Exzellenz – sie ist eine ergänzende Dimension, keine Lösung für systemische Probleme.
Der Beitrag wurde verfasst von Charlotte Wangemann.