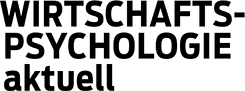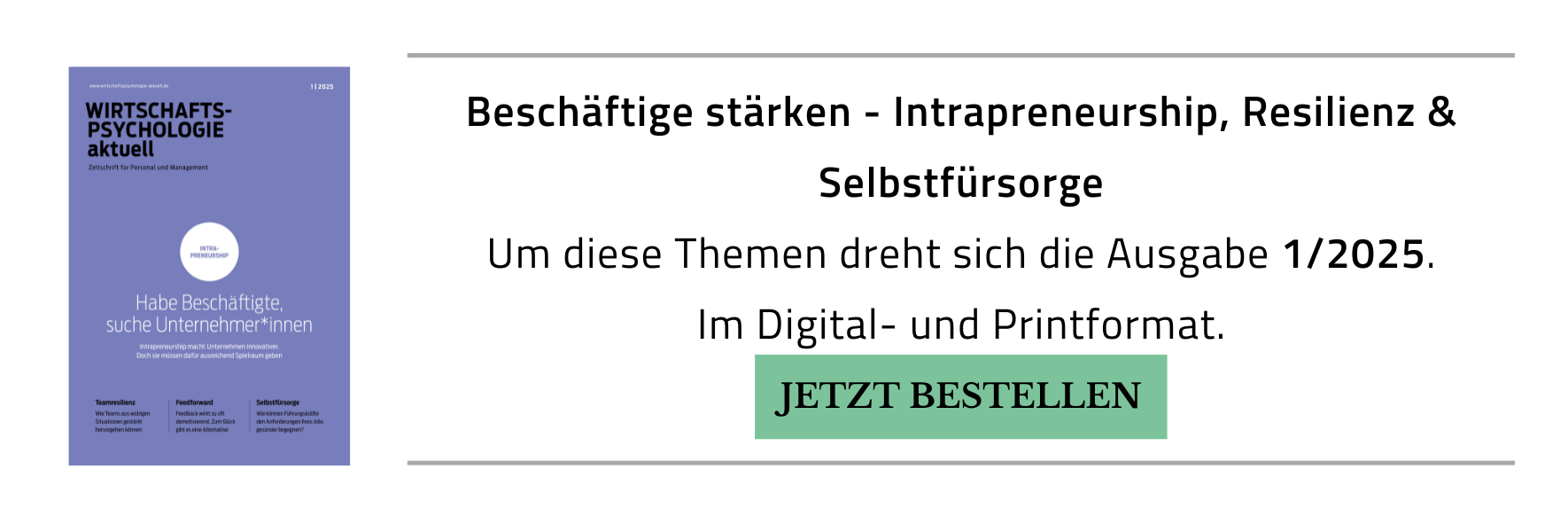Wir Menschen sprechen nicht nur mit anderen Menschen, sondern auch mit uns selbst. Selbstgespräche können uns anspornen, aber auch demotivieren. Sie können uns ablenken oder unsere Aufmerksamkeit lenken. Die Sportpsychologie bietet hierzu wertvolles Wissen, das sich auch auf den Arbeitskontext übertragen lässt.
Gedanken äußern sich in Selbstgesprächen. Bei Selbstgesprächen handelt es sich um Verbalisierungen, die gegenüber sich selbst geäußert werden. Dabei kann laut gesprochen werden oder nur innerlich.
Im Leistungssport gelten Selbstgespräche als ein wichtiger psychischer Prozess, der die Leistung beeinflusst (Hatzigeorgiadis et al., 2011). Motivierende Selbstgespräche reduzieren beispielsweise das Anstrengungserleben bei Ausdauersportler:innen und fördern so deren Leistung (Blanchfield et al., 2014).
Selbstgespräche im Arbeitsalltag
Auch im Arbeitsalltag spielen Selbstgespräche eine Rolle. Inneres Sprechen gilt als gedankliches Handeln (Hacker & Pohlandt, 2024). Selbstgespräche geben bei der Arbeit Rückmeldung, sodass
- Gedanken und Lernabsichten bewusst gebildet werden,
- „Mind-Wandering“ reduziert wird oder/und
- Handlungsziele weiterverfolgt werden.
Sowohl bei routinierten Handlungen als auch in besonderen Leistungssituationen können Selbstgespräche hilfreich sein. Bei routinierten Handlungen treten sie oft verkürzt auf, sodass bereits einzelne Begriffe Handlungsprogramme in Kraft setzen. Beispielsweise erinnert sich ein:e Mitarbeiter:in durch das innere Kommando „Jetzt ablegen“ daran, die Unterlage im neuen Dokumentenmanagementsystem abzulegen. Bei neuen Situationen können Selbstgespräche das Lernen fördern, insbesondere, wenn diese Fragen beinhalten wie
- „Auf welche Erfahrungen kann ich aufbauen?“
- „Welche Fehler könnten auftreten?“
- „Welche Beispiele gibt es, von denen ich mir etwas abschauen kann?“
Spontane vs. zielgerichtete Selbstgespräche
Spontane und zielgerichtete Selbstgespräche unterscheiden sich in ihrem Bewusstseinsgrad. Spontane Gespräche basieren eher auf einer intuitiven Informationsverarbeitung, während zielgerichteten Selbstgesprächen eher eine kontrollierte Informationsverarbeitung zugrunde liegt (Latinjak et al., 2020).
In spontanen Selbstgesprächen drücken sich
- Emotionen wie Freude („Das war toll gemacht!“) oder Scham („Ich bin ein:e Versager:in“),
- das Erleben von Anstrengungen („Das zieht sich wie Kaugummi“),
- Gedanken zu Ursachen von Erfolg („Ich bin gut in Form“) oder
- Misserfolg („Heute ist nicht mein Tag) aus.
Auch wenn diese Selbstgespräche nicht bewusst und kontrolliert eingesetzt werden, können sie Ziele beeinflussen, indem sie uns pushen oder demotivieren. So kann es beispielsweise sein, dass wir im Arbeitsalltag eine schwierige Aufgabe aufgrund von spontanen Selbstgesprächen („Heute ist nicht mein Tag“) unterbrechen und aufschieben („Das bringt jetzt nichts. Ich brauche erst einmal eine Pause“).
Zielgerichtete Selbstgespräche lassen sich im Alltag bei aufkommenden Problemen nutzen. Sie werden geplant eingesetzt und erfordern dadurch Energie. Wir versuchen so unsere
- Emotionen zu beeinflussen („Nicht zu hektisch herangehen“),
- unsere Aufmerksamkeit auszurichten („Ich sollte die Datei erst einmal speichern“) und
- uns zu motivieren („Weiter so! Das läuft gut!“).
Es kann dabei gelingen, dass funktionale Selbstgespräche automatisiert und damit als organische Selbstgespräche wirksam werden. Beispielsweise könnten Mitarbeitende es sich zur Gewohnheit machen, bei neuen Situationen durch Fragen einen inneren Dialog anzustoßen.
Strategische vs. reflexive Selbstgespräche
In der Sportpsychologie werden noch strategische und reflexive Selbstgespräche unterschieden (Latinjak et al., 2020).
Strategische Selbstgespräche sind zielgerichtet und werden zumeist in Interventionen erarbeitet. Die Nutzung von Cue-Words in Training und Wettkampf ist elementar. Durch einzelne Wörter werden mentale Zustände aktiviert, die sich als leistungsförderlich erweisen. Mit dem Cue-Wort „Pace halten“ – kann sich z. B. ein Marathonläufer darauf fokussieren, die Geschwindigkeit zu halten, um sich nicht zu verausgaben. Eine Führungskraft kann durch Cue-Wörter wie „Erst zuhören“ in einem konfliktbehafteten Mitarbeitendengespräch den Impuls, direkt zu sprechen, regulieren.
Reflexive Selbstgespräche finden im Dialog z. B. mit Coaches statt. Sie haben die spontanen Selbstgespräche in Leistungssituationen zum Gegenstand. Ein stärkeres Bewusstsein über die spontan aufkommenden Selbstgespräche kann dann helfen, in künftigen Situationen funktionale Selbstgespräche zu fördern und dysfunktionalen Selbstgesprächen etwas entgegenzusetzen.
Parallelen zum inneren Team und inneren Antreiber
Selbstgespräche weisen Parallelen zur Metapher des inneren Teams von Schulz von Thun (1998) auf, mit dem u. a. innere Dialoge beschrieben werden. Beim inneren Team geht es vor allem darum, dass Ambivalenzen zum Ausdruck kommen, die in der Metapher durch verschiedene innere Teammitglieder repräsentiert werden. Dies entspricht weitgehend spontanen Selbstgesprächen. Das Modell des inneren Teams sieht jedoch auch Konzepte wie innere Führung oder Aufstellung für bestimmte (Leistung-)Situationen vor. Dies entspricht dann zielgerichteten und strategischen Selbstgesprächen. Auch zu dem Konzept der inneren Antreiber (Kahler, 1975), die in Appellen wie „Beeil Dich“!“ oder „Sei perfekt“ prägnant beschrieben werden, gibt es Überschneidungen. Innere Antreiber sollten sich in Selbstgesprächen bemerkbar machen und dadurch Stress auslösen oder verstärken. Die Annahme ist, dass es Muster gibt, die immer wieder auftauchen. Es handelt sich vorwiegend um spontane Selbstgespräche. Reflexive Selbstgespräche können helfen, die „inneren Antreiber“ aufzudecken. Strategische Selbstgespräche eignen sich wiederum dazu, die Wirkung der „inneren Antreiber“ zu unterbrechen (z. B. „Stopp!“, „Innehalten“) und die eigenen Handlungen besser zu regulieren.
Fazit
Sprache beeinflusst unser Erleben und Verhalten durch Selbstgespräche. Aus der Sportpsychologie gibt es eine differenzierte Betrachtung von Arten der Selbstgespräche und ihrer Wirkweise. Dieses Wissen ist auch außerhalb des Sports von großem Nutzen und zeigt im Arbeitsalltag in Organisationen Ansätze auf, wie Sie die Wirkung von Selbstgesprächen besser nutzen können.