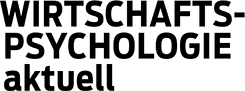Viele Arbeitnehmende schätzen das Homeoffice, doch es geht oft auf Kosten des Vertrauens und der Kreativität in Teams. In seinem neuen Buch „Kettensprenger“ setzt sich Prof. Dr. Ingo Hamm mit diesem Problem auseinander. Im Interview erklärt er, wie wir Freiheit neu denken müssen, um in Freiheit gemeinsam besser zu arbeiten.
Herr Hamm, von welchen „Kettensprengern“ handelt Ihr Buch?
Von den Arbeitnehmenden, die sich mehr Freiheit im Job wünschen. Oft geht es dabei um das Homeoffice, das für viele seit der Corona-Pandemie selbstverständlich ist. Als Mitarbeitende jedoch nach der Pandemie an den Arbeitsplatz zurückkehren sollten, reagierten viele aufgebracht und in Unternehmen entstanden enorme Spannungen.
Auch wenn Homeoffice für viele Freiheit bedeutet, müssen wir drei große unbequeme Wahrheiten im Blick haben: Erstens entsteht Vertrauen in Teams viel besser in Präsenz als virtuell, insbesondere, wenn man neu in ein Unternehmen kommt. Zweitens sind digital arbeitende Teams weniger kreativ als in Präsenz arbeitende Teams. Und drittens entsteht Resilienz im Team hauptsächlich, wenn man sich an demselben Ort befindet. Diese unbequemen Wahrheiten müssen Mitarbeitende akzeptieren, so attraktiv das Homeoffice auch ist.
Warum ist Mitarbeitenden das Homeoffice so wichtig?
Es gibt unterschiedliche Gründe, die ich fünf Motivationstypen zugeordnet habe. Diese Einteilung ist eine Vereinfachung, basiert vorrangig auf Erfahrung und deckt nicht alle Menschen ab, doch sie hilft dabei, individuelle Bedürfnisse besser zu verstehen.
Zunächst gibt es die sogenannten Verweiger*innen. Teils mit krimineller Energie täuschen sie im Homeoffice bloß vor, zu arbeiten, tun aber in Wahrheit nichts bis wenig. Dieser Typus steht im Zentrum der Homeoffice-Debatte, weil Verweiger*innen das Arbeitsklima kaputtmachen können, doch nur wenige Menschen fallen in diese Kategorie.
Dann gibt es die Jongleur*innen, die in ihrem Leben unheimlich viele Bälle in der Luft halten: Beruf, Kinderbetreuung, Pflege, private Termine usw. Ohne das Homeoffice würden sie ihr Leben nicht organisiert kriegen.
Die Eskapist*innen entfliehen einer toxischen oder als demotivierend empfundenen Arbeitsumgebung und sehnen sich nach Selbstwirksamkeit und Erfüllung, oft jenseits der Arbeit. Sie haben zwar noch Motivation und Spaß an der Arbeit, aber nicht unbedingt in der aktuellen Rolle.
Essentialist*innen schätzen das Homeoffice, weil sie dort konzentriert und in Ruhe arbeiten können. Sie laufen jedoch Gefahr, professionell zu vereinsamen, wenn Effizienz zu sehr auf Kosten des Zusammenhalts geht und dadurch das Zugehörigkeitsgefühl schwindet.
Für die Fatalist*innen ist das Homeoffice der letzte Schritt vor dem kompletten Zusammenbruch. Statt sich wegen Burnouts krankschreiben zu lassen, ziehen sie sich immer weiter zurück und arbeiten im Homeoffice, bis gar nichts mehr geht.
Wie können Führungskräfte den vielfältigen Bedürfnissen gerecht werden?
Führungskräfte sollten sich individuell über die Mitarbeitenden und deren Motive Gedanken machen, damit sie angemessen entscheiden können. Das ist wie auf einem Schiff: Bei gutem Wetter braucht es wenig Führung. Wenn aber der Sturm aufkommt, muss die Führungskraft den Überblick haben. Wer ist so erfahren, dass keine Führung nötig ist? Wer braucht mehr Unterstützung? Sie können nicht einfach zehn Regeln an den Mast hämmern, sondern müssen sich individuell und situativ mit dem Team auseinandersetzen.
Ansonsten gilt: Wir brauchen Präsenzarbeitsphasen, um Vertrauen, Kreativität und Resilienz zu fördern, aber wir sollten sie sinnvoll einsetzen, z. B. durch Kreativverfahren mit externer Moderation oder an einem externen Ort. Man schaut gemeinsam auf Probleme, man diskutiert, sammelt Impulse und geht in offene Feedbackgespräche. Wenn das gut gestaltet ist, zahlt sich Präsenzzeit aus, auch aus Mitarbeitendensicht.

Im Gespräch mit Prof. Dr. Ingo Hamm (Foto: Julian Beek)
Sind hybride Arbeitsmodelle mehr als ein Kompromiss zwischen Remote und Präsenz?
Ja. Hybrid meint keinesfalls die meist unbefriedigenden Mischformate, in denen ein Teil im Raum sitzt und der Rest digital zugeschaltet wird. Es gilt, bewusst zu entscheiden, was remote und was offline besser funktioniert. Hybrides Arbeiten sollte so organisiert sein, dass Arbeit insgesamt gesünder und produktiver stattfindet. Leider wird viel über das optimale Verhältnis von Homeoffice und Präsenz diskutiert. Es gibt auch Studien, deren Ergebnisse eine bestimmte Gewichtung optimal erscheinen lassen. Letztlich hängt es jedoch immer vom Einzelfall und von der Führung ab, welches Format funktioniert.
Es ist schade, wenn Freiheit für Mitarbeitende nur die Befreiung von unangenehmen Arbeitsbedingungen bedeutet, denn wir finden sie auch in der Teamzusammenarbeit. Dafür müssen wir Freiheit in der Arbeit anders denken. Wenn sich alle nur allein im Homeoffice frei fühlen, entsteht nichts Großes. Ich möchte daher den Blick auf die Ziele lenken, die man gemeinsam als Unternehmen erreichen kann. Dieses „Wir“ schließt individuelle Freiheit nicht aus.
Was erhöht die Akzeptanz beim Personal für Hybridlösungen?
Zunächst muss das Ziel klar sein, damit Mitarbeitende verstehen, dass die Präsenzzeit nicht bloß der Kontrolle dient. Wenn man hört, es geht um gutes Onboarding oder um kreative und innovative Produktentwicklung, wird eine Rückkehr aus dem Homeoffice eher akzeptiert. Der zweite Schritt ist die Art der Gestaltung: An welchen Tagen kommen wir wann wofür zusammen? Dabei braucht es oft auch eine gewisse Durchsetzungsstärke. Ein Beispiel: Angenommen, eine Fußballmannschaft mit 11 Spieler*innen hat 50 Wochen à 5 Tage Zeit zu trainieren. Wenn die Spieler*innen sagen, dass sie wegen privater Verpflichtungen nur an drei Tagen in Präsenz trainieren können, dann wäre das Team – mathematisch betrachtet – im ganzen Jahr nur an einem Tag vollständig. Diese Zahl wird nicht dramatisch besser, wenn wir von vier Präsenztagen ausgehen.
Man merkt, dass es unheimlich schwer ist, ein Hybridformat so zu organisieren, dass das Team als Ganzes zusammenarbeitet. Diese neue Realität ist anstrengend für beide Seiten und erfordert Zugeständnisse, Planungsaufwand und teilweise das harte Durchgreifen von Unternehmen.
Welcher Führungsstil ist hilfreich, um diese Herausforderungen zu meistern?
Die Situational Leadership Theory von Paul Hersey und Ken Blanchard unterscheidet vier Führungsstile: Telling meint, dass eine Führungskraft ansagt, was zu tun ist, etwa bei einfachen Tätigkeiten, unmotivierten Mitarbeitenden oder in akuten Krisensituationen. Delegating ist das Gegenteil, also dass Aufgaben komplett delegiert werden, was mit kompetenten, motivierten Angestellten gut funktioniert. Ist die Motivation bei kompetenten Mitarbeitenden unklar oder sogar gering, braucht es weitere Führungsstile: Mit dem Selling überzeugt man nicht klar motivierte Angestellte, indem man aus der Aufgaben- in die Beziehungsorientierung geht, und beim Participating werden unsichere oder skeptische Mitarbeitende mitgenommen, indem die Führungskraft ihrer Vorbildfunktion gemäß selbst mitmacht und in die Aufgabe mit reingeht. All diese Führungsstile sind in der hybriden Arbeitswelt erforderlich.
Welche Hindernisse sehen Sie bei der Vereinigung von individueller Freiheit und Zusammenhalt?
Ein Hindernis ist eine große Führungsunsicherheit, aus der heraus Mitarbeitende pauschal ins Büro zitiert werden, anstatt dass situativ entschieden wird. Ein anderer Aspekt sind die sogenannten stillen Motive. Arbeit ist mehr als ein Austausch von Zeit gegen Gehalt. Die Arbeits- und Teamumgebung ist immer auch ein emotionaler und sozialer Ort, an dem Menschen sich einbringen und verwirklichen, Wertschätzung erfahren wollen und soziales Feedback suchen. Menschen sind keine Roboter oder KIs, die einfach nur Dinge abarbeiten, sondern sie wollen sich entwickeln und wachsen. Die stillen Motive muss die Psychologie in die Debatte reinbringen, in der es zu sehr nur um Arbeitszeiten und andere organisatorische Fragen geht. Die meisten Führungskräfte qualifizieren sich nämlich vor allem fachlich für ihre Position, sind jedoch überfordert, wenn plötzlich das Menschliche enorm wichtig und herausfordernd wird. Unternehmen müssen Manager*innen entsprechend fit machen.
Wie wird der Streit um das Homeoffice weitergehen?
Ich halte es für unrealistisch, dass wir das dezentrale Arbeiten im Homeoffice komplett rückgängig machen, auch wenn gerade in vielen Unternehmen das Pendel dahin ausschlägt. Trotzdem verlangen die Herausforderungen unserer Zeit nach mehr Kooperation, in anderer Form als gewohnt. Wir müssen wieder intensiver in Teams und mit Führungskräften zusammenarbeiten. Wir müssen neue Modelle entwickeln, damit Kooperation funktionieren kann, auch wenn sich dabei das Ausmaß der individuellen Freiheit verändert.
Vielen Dank für das Gespräch!
Wir sprachen mit:
Prof. Dr. Ingo Hamm ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Darmstadt sowie Autor, Redner & Berater. Im Juli ist sein Buch „Kettensprenger“ (s.u.) erschienen.
Zum Weiterlesen:
[Werbung] Hamm, I. (2025). Kettensprenger. Mehr Freiheit, mehr Wir – Der Weg zur selbstbestimmten und erfolgreichen Arbeit. Für alle, die mehr vom Job erwarten als nur ein Gehalt. Vahlen.