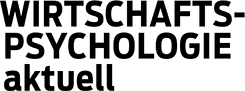Psychologische Sicherheit ist zum Dauerthema in HR-Debatten geworden. Viele verbinden damit die Hoffnung auf mehr Empowerment im Team. Doch eine aktuelle Studie zeigt: So einfach ist es nicht. Der Zusammenhang zwischen beiden existiert zwar, aber er ist anfälliger für Störungen, als viele denken.
Kritik äußern, Fehler offen ansprechen, neue Ideen einbringen und all das ohne Angst vor Abwertung – das ist psychologische Sicherheit (Edmondson, 1999). Das Konzept hat in den letzten Jahren enorm an Aufmerksamkeit gewonnen, besonders in Diskussionen über moderne Führung und agile Zusammenarbeit. Dahinter steht die intuitive Annahme: Wer sich im Team sicher fühlt, kann freier handeln, übernimmt eher Verantwortung und fühlt sich insgesamt wirksamer – kurz: empowerter. Doch wie robust ist dieser Zusammenhang? Gilt er für alle Aspekte von Empowerment gleichermaßen? Und was passiert, wenn Teams unter Druck geraten, etwa durch Krisen oder interne Konflikte?
Dr. Laura Creon und Prof. Dr. Carsten Schermuly (2024) von der SRH Berlin, University of Applied Sciences, sind diesen Fragen nachgegangen. Ihre zentrale These: Der Zusammenhang zwischen psychologischer Sicherheit und Empowerment könnte komplexer und kontextabhängiger sein als bisher angenommen. Empowerment besteht aus vier Dimensionen – Sinnerleben, Kompetenz, Selbstbestimmung und Einfluss (Spreitzer, 1995). Möglicherweise profitiert nicht jede Dimension gleich stark von psychologischer Sicherheit. Und möglicherweise wird der Zusammenhang schwächer, wenn Teams von außen (etwa durch eine Pandemie) oder von innen (durch wahrgenommene Spaltungen) unter Druck geraten.
Was wurde genau untersucht?
Um ihre Vermutungen zu prüfen, führten die Autor*innen drei Studien mit insgesamt über 500 Beschäftigten in Deutschland durch: einmal in einem Industrieunternehmen (134 Personen) und zweimal mit Teilnehmenden aus unterschiedlichen Organisationen (jeweils knapp 200 Personen). Mit zeitlichem Abstand zwischen den Messungen erfassten sie, wie sicher sich die Befragten im Team fühlten und wie sehr sie sich als empowert erlebten. Auch wurde der Einfluss von Krisen und Spannungen im Team erfasst.
Was sind die Ergebnisse?
Erstens: Die Autor*innen fanden in zwei von drei Studien einen positiven Zusammenhang zwischen psychologischer Sicherheit und Empowerment. Das auffälligste Ergebnis: Die Dimension Selbstbestimmung wies in allen drei Studien eine der stärksten Beziehungen zu psychologischer Sicherheit auf. Wo Sicherheit spürbar ist, erleben somit Mitarbeitende häufiger, dass sie sie ihre Arbeit selbstbestimmt gestalten können. Die Ausprägungen auf den anderen drei Dimensionen – Sinnerleben, Wirksamkeit und Kompetenz – schwanken stärker je nach Kontext. Die Studienautor*innen sagen dazu:
„Selbstbestimmung bedeutet, selbst entscheiden zu können, wie man seinen Job ausführt. Dazu kann gehören, dass man neue Wege ausprobiert, sich auch mal verrennt und Fehler macht und vielleicht mal bei anderen nachfragen muss. Für all dies braucht es möglichst hohe psychologische Sicherheit. Die anderen Dimensionen von psychologischem Empowerment könnten stärker von individuellen oder Kontextfaktoren abhängen, obwohl auch sie von psychologischer Sicherheit profitieren. Zum Beispiel erlebe ich meinen Job als Investmentbanker vielleicht trotz psychologischer Sicherheit als weniger sinnvoll, wenn er nicht zu meinen Idealen passt. Und als Astrophysikerin kann ich mich auch trotz hoher psychologischer Sicherheit als weniger kompetent erleben, wenn meine Experimente immer wieder schief gehen.“
Zweitens: Der beobachtete Zusammenhang zwischen psychologischer Sicherheit und Empowerment wird in Krisenzeiten schwächer. In der Studie, die während der ersten Corona-Welle durchgeführt wurde, zeigte sich der positive Zusammenhang nur, wenn Beschäftigte die Veränderungen als wenig belastend empfanden. Ein Jahr später, als sich viele an die neue Situation gewöhnt hatten, trat dieser Effekt nicht mehr auf. Creon und Schermuly bezeichnen diese Beobachtungen als die überraschendsten Ergebnisse ihrer Studie:
„Diese Ergebnisse würden wir im Nachhinein als Momentaufnahme deuten, die zeigen, wie stark die Veränderungen durch die Pandemie die Menschen in ihrem Arbeitsalltag beeinträchtigt haben. Dass der Effekt ein Jahr später nicht mehr zu finden war, lässt vermuten, dass der Zusammenhang von psychologischer Sicherheit und Empowerment robust ist und sich auch von großen Krisen erholen kann.“
Drittens: Die Autor*innen zeigten außerdem, dass wahrgenommene Teamspaltungen den positiven Zusammenhang zwischen psychologischer Sicherheit und Empowerment schwächen können.
Insgesamt deuten die Befunde darauf hin, dass psychologische Sicherheit und Empowerment eng zusammenhängen, besonders bezüglich des Gefühls, selbstbestimmt handeln zu können. Sie wirkt jedoch nicht automatisch: Krisen und Teamspaltungen können die Wirkung deutlich verringern.
Wie lässt sich psychologische Sicherheit im Alltag fördern?
Aus den Studienbefunden lassen sich einige Ansatzpunkte ableiten, wie psychologische Sicherheit im Arbeitsalltag gestärkt werden könnte:
- Bewusstsein schaffen: Teammitglieder und Führungskräfte sollten über den Zusammenhang zwischen psychologischer Sicherheit und individuellem Empowerment aufgeklärt werden. Wenn sie verstehen, wie sich Sicherheit auf ihre Selbstbestimmung auswirkt, können sie aktiv zur psychologischen Sicherheit beitragen.
- Sicherheitssignale bewusst senden: Die Studie legt nahe, dass psychologische Sicherheit über vier Wege wahrgenommen wird: durch direkte Aussagen („Hier kann jede*r seine Meinung sagen“), durch Aufmerksamkeitslenkung (Wertschätzung von Speaking-up betonen), durch positive Deutung (Speaking-up als Lernchance darstellen) und durch sichtbare Reaktionen (konstruktiver Umgang mit Kritik am Status quo).
- In Krisenzeiten besonders aufmerksam sein: Den Befunden nach kann der Zusammenhang zwischen psychologischer Sicherheit und Empowerment in unsicheren Zeiten schwächer werden. Führungskräfte sollten daher in Krisen besonders darauf achten, ein sicheres Klima aufrechtzuerhalten – etwa durch Resilienz-Trainings oder Unterstützungsangebote.
- Bei Teamspaltungen sensibel reagieren: Um einen negativen Effekt von wahrgenommenen Teamspaltungen zu verhindern, empfehlen die Autor*innen, Spaltungen anzusprechen und gemeinsam zu reflektieren. Konkrete Interventionsstrategien schlagen sie nicht vor, da die Befundlage noch nicht ausreichend ist.
Empfehlungen für Führungskräfte
Wenn Sie Ihr Team derzeit durch eine unsichere Phase führen, empfehlen Ihnen Creon und Schermuly zuvorderst, Ihrem Team zu vertrauen:
„Gerade in unsicheren Zeiten neigen Führungskräfte mehr zu Mikromanagement. Das ist erstmal menschlich verständlich, aber für die Zusammenarbeit und die Arbeitsergebnisse sehr hinderlich. Psychologische Sicherheit und psychologisches Empowerment sind gerade in unsicheren Zeiten besonders gefordert. Für beides muss ich als Führungskraft meinem Team vertrauen, dass es Fehler benennt, zweifelhafte Entscheidungen kritisch hinterfragt und, wenn nötig, um Unterstützung bittet.“
Limitationen der Studie und Ausblick
Die Studienergebnisse stammen aus Befragungen und korrelativen Daten. Sie zeigen folglich stabile Zusammenhänge, aber keine eindeutigen kausalen Effekte. Somit bleibt offen, ob Menschen, die sich empowert fühlen, zugleich auch psychologische Sicherheit erleben, oder ob psychologische Sicherheit tatsächlich zu mehr Empowerment führt.
Zudem stammen die Daten aus Deutschland und aus der Pandemiezeit. Die Stärke der Effekte könnte in anderen Ländern, Branchen oder Arbeitsformen variieren.
Für zukünftige Studien empfehlen die Autor*innen, gezielte Experimente durchzuführen, um Kausalzusammenhänge zu prüfen. Außerdem sollten verschiedene Arbeitskontexte miteinander verglichen werden – etwa unterschiedliche Branchen (Pflege vs. IT), Arbeitsformen (Büro vs. Homeoffice) oder Hierarchieebenen. So ließe sich besser verstehen, wann psychologische Sicherheit besonders wichtig ist und wann andere Faktoren wie Ressourcenausstattung, Rollenklarheit oder Führungsverhalten einen größeren Einfluss auf Empowerment haben.
Fazit
Psychologische Sicherheit und Empowerment hängen zusammen – besonders wenn es um Selbstbestimmung geht. Wie die Studie zeigt, ist dieser Zusammenhang jedoch komplex und kontextabhängig. In unsicheren Zeiten oder bei fehlendem Zusammenhalt kann er schwächer ausfallen. Ob psychologische Sicherheit tatsächlich zu mehr Empowerment führt oder beide Phänomene gemeinsame Ursachen haben, bleibt offen. Klar ist aber: Wer Empowerment fördern will, sollte psychologische Sicherheit nicht vernachlässigen, denn Menschen, die sich sicher fühlen, erleben sich bei der Arbeit häufiger als selbstbestimmt und wirksam.
Wir bedanken uns herzlich für den offenen Austausch mit Dr. Laura Creon und Prof. Dr. Carsten Schermuly und für ihre Bereitschaft, ihre Erkenntnisse mit uns zu teilen.
Den Beitrag verfasste Charlotte Wangemann.
Literatur
Creon, L. E., & Schermuly, C. C. (2024). Feeling safe to be empowered: Psychological safety and psychological empowerment in threatening work environments. German Journal of Human Resource Management, 1–29. https://doi.org/10.1177/23970022241284536.
Edmondson, A. (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams. Administrative science quarterly, 44(2), 350-383.
Spreitzer, G. M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation. Academy of Management Journal, 38(5), 1442–1465. https://doi.org/10.2307/256865